
Title: Adolf Schreiber
Ein Musikerschicksal
Author: Max Brod
Release date: July 7, 2025 [eBook #76456]
Language: German
Original publication: Berlin: Welt-Verlag, 1921
Credits: Jana Srna and the Online Distributed Proofreading Team at https://www.pgdp.net (This file was produced from images generously made available by The Internet Archive)
Anmerkungen zur Transkription
Der vorliegende Text wurde anhand der Buchausgabe von 1921 so weit wie möglich originalgetreu wiedergegeben. Offensichtliche Fehler wurden stillschweigend korrigiert. Ungewöhnliche und heute nicht mehr verwendete Schreibweisen bleiben gegenüber dem Original unverändert.


Eine Auswahl aus Adolf Schreibers Kompositionen ist unter dem Titel „Zehn Lieder“ im gleichen Verlag erschienen. Nähere Angaben am Schlusse dieses Buches.
MAX BROD
Ein Musikerschicksal
1921 / IM WELT-VERLAG / BERLIN
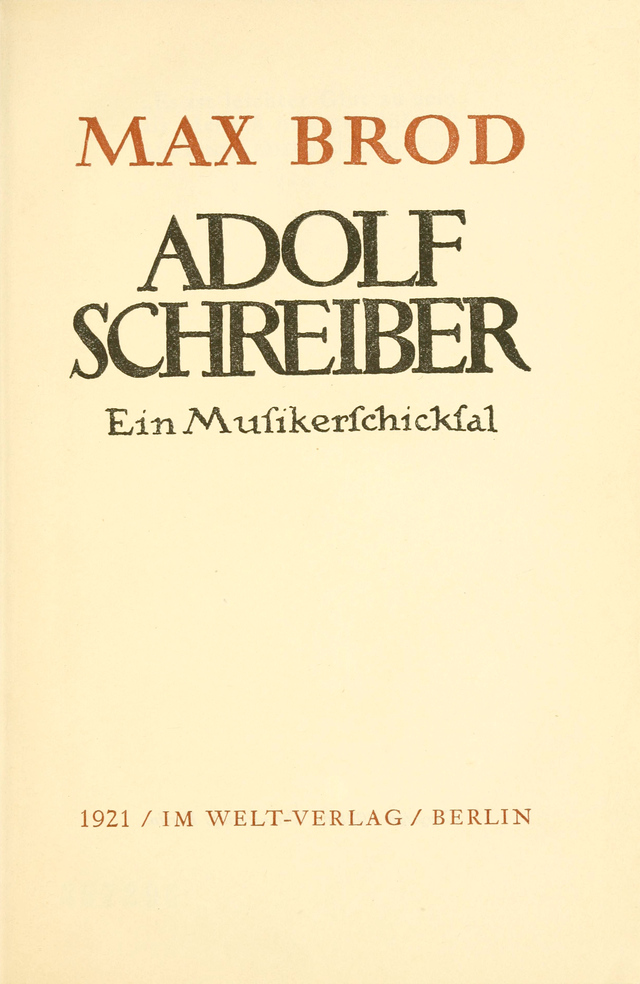
Copyright 1921 by Welt-Verlag, Berlin.
„Es ist leichter Glut zu sein
als Mensch und zu glühen.“
AUS EINEM BRIEFE A. SCHREIBERS.
‹ 7 ›
AM 1. September 1920 lief Adolf Schreiber aus dem unwirtlichen Berlin in den Wannsee. — Flüchtig begann die Tagespresse sich mit ihm zu beschäftigen. „Selbstmord eines Künstlers“ — „Künstlerschicksal“. Ein paar Notizen, eine interessant aufgetupfte Farbe in einigen Feuilletons. „Typischer Fall“ hieß es. Aber das war der Fall gar nicht, war im Gegenteil ein Äußerstes an Kompliziertheit, Seltsamkeit. Als solcher freilich hätte er einen grellen Reflex auf das Typische werfen können. Aber nur die Nächststehenden wußten das. In Zeilen von Adolf Heilborn, Auguste Hauschner blitzte es auf. Dann wurde es wieder sehr schnell still.
In diesen Zeilen war daran erinnert worden, daß Adolf Schreibers tiefverborgenes Leben schon einmal ohne seinen Willen in die Öffentlichkeit gezogen worden war. Durch einen Artikel von mir, einen Verzweiflungsschrei. Siegfried Jacobsohns „Schaubühne“ hatte im Mai 1913 das Folgende gebracht, als meinen
„AUFRUF AN DIE MUSIKFREUNDE“.
„Bene qui latuit, bene vixit“??
„Dichtungen schreiben und Verbindungen anknüpfen ist zweierlei. Darf es aber dem jungen Autor leider nicht sein, von besonderen‹ 8 › Glücksfällen eines Porphyrogenitus abgesehen. Meist wird nur ein Gang zu fremden Leuten, ein Eindringen in unbekannte Redaktionsräumlichkeiten über den Abdruck des ersten Gedichtes, des ersten Buches entscheiden.
„Noch viel, viel schlimmer hat es ein Komponist. Der Notendruck ist teurer; und wer kauft Werke eines neuen Musikers! Die Verleger der Musikliteratur haben daher taube Ohren für neue Musik. Und eine Aufführung bedarf eines großen Apparats. Der junge Komponist muß also auf den Mäcenas und Apostel in einer Person warten. Fall Hugo Wolf und andre.
„Ich würde mich gar nicht darüber wundern, wenn im Nachlaß eines unbekannten alten Mannes kostbarste Musik aufgefunden würde. Nichts hat es auf der Welt so leicht, sich zu verstecken wie gute Musik.
„Es ist leider nicht naturnotwendig, daß geniale Musik-Inspirationsfülle mit einer gewissen Vordringlichkeit und Ausdauer des um die erste Aufführung buhlenden Benehmens sich paare. Andrerseits ist das ja sehr schön und keusch. Aber traurig bleibt es, daß der Komponist Adolf Schreiber, obwohl er seit‹ 9 › Jahren in Berlin lebt, es durch die einfachen menschlichen Eigenschaften der Bescheidenheit und Zurückhaltung durchgesetzt hat, nur von einigen Zufallsbekanntschaften angehört zu werden.
„Und doch ist die Musik dieses nicht mehr ganz jungen Mannes das Wichtigste und Ergreifendste, was mir seit Jahren erklungen ist. Schreiber hat zahlreiche Klavierkompositionen, Violinsonaten, Fugen, Orchesterwerke in seinen Schubläden. Und die Lieder, was für Lieder! Seine Melodien zu Prosazeilen Peter Altenbergs, seine naiven, kraftstrotzenden Balladentöne für Liliencron haben mich einen ganzen Sommer lang mit unendlichem Glück gesegnet. Ich sage es kurz: eine ganz originelle Eigenart gibt sich hier kund, ein ganz Natürliches, ohne besondere Komplikation ein bisher durch Zufall unbekanntes Grundelement der Musik.
„Aber der Komponist selbst ist selbstverneinend, fast asketisch, er tut keinen Schritt für sich, er ist ein heroischer Ausnahmemensch. Diese Zeilen schreibe ich ohne sein Wissen, vielleicht gegen seinen Willen. Ich frage ihn nicht, ich frage niemand. Ich hasse den stupiden Zufall, der (was ja sehr schön und‹ 10 › keusch ist — bene qui latuit, bene vixit) Genialität und Selbstverkleinerung in dieselbe Brust eingebaut hat. Ich wende mich an die Öffentlichkeit. Ich bürge mit meiner ganzen Person, mit meinem Ansehen und mit der Zukunft meines Ansehens für die magische Gewalt der Kompositionen Adolf Schreibers.
„Ich frage: Welcher Sänger, welche Sängerin studiert die Lieder Adolf Schreibers? Welcher Verleger bietet sich zur Drucklegung an? Wer veranstaltet den ersten Liederabend, den ersten Kompositionsabend für Schreiber?
„Die Adresse: Kapellmeister Adolf Schreiber, Berlin-Halensee, Joachim-Friedrichstraße 2.“
Diese schrille Lichtreklame war nur eine von den vielen, die ich längs der Bahn Adolf Schreibers angezündet habe. Nicht die erste und nicht die letzte. Ich hatte mir damals, nach vielen Fehlschlägen, vorgenommen, um jeden Preis und geradezu mit Erbitterung das Schweigen rings um meinen Freund zu sprengen.
Es ist absolut mißlungen. Nicht den geringsten Erfolg habe ich für ihn erzielt. — Ich betrachte das als einen Teil des mir persönlich‹ 11 › zugestoßenen Unglücks und Unrechts, als einen ganz beträchtlichen Teil meines Mißgeschicks. — Wer Glück hat, hat es nicht nur für sich, sondern auch für die, denen er helfen will. Hätte sich doch Adolf Schreiber einen mit weniger Mißgeschick behafteten Freund erwählt!
O, wie bitter es ist, dies niederzuschreiben — jetzt, da alles vorbei ist.
Was geschah nach jenem gewagten, nahezu unschicklichen, gewissermaßen von Schamröte erglühenden Aufruf 1913? — Ein Kammersänger meldete sich, ließ aber nach einigen Briefen die Sache fallen. Ferner forderte der Direktor einer Filmgesellschaft Musik zu Gerhart Hauptmanns „Atlantis“. Auch daraus wurde nichts. Schreiber komponierte. Ob aber die Musik zur Aufführung gelangt ist, weiß ich nicht. Jedenfalls wirkte sie nicht nach. — Das war alles. Mehr habe ich nicht gehört. Wiederum schloß sich um den Lebenden das Lehmgrab, das er mit sich trug, mitten durch das energieplatzende Berlin um seine Schultern mit sich trug.
Allerdings war das auch seine eigene Schuld, — sofern man von Schuld hier sprechen will. Ein anderer hätte die „Situation ausgenützt“. Schreiber machte gewiß einen Kreis rings um sie. Er wich ja allem Guten, Günstigen aus, das sich‹ 12 › anbot. Jemand hätte da sein müssen, ihn zu zwingen. — Ein typischer Fall? Nein, ein geradezu phantastischer. Und er zeigt so richtig die ganze Phantastik der Kunst in dieser Welt. Da gab es also einen Menschen, der die Kunst ganz ernst nahm und sonst gar nichts. Der von Nebendingen, Geschicklichkeiten des Lebens nichts, aber auch nicht das Mindeste wußte. So sehr nicht das Mindeste, daß er nicht nur alles falsch packte, dort scherzte, wo es ernst wurde, und dort ernsthaft drauflosarbeitete, wo es nicht der Rede wert war, — nein, mehr noch, daß er direkt gegen sich lebte, Schützengräben anlegte zwischen sich und seinem Glück, — eine Haltung, die aber durchaus ableitbar ist aus dem redlichen Gemüt eines, der eben nur die Kunst ernst nimmt und sonst gar nichts. Er hatte nur seine Musik, alles andere hätten die andern für ihn haben müssen. — Sofort erhebt sich die Forderung, daß man ihm nicht nur hätte helfen, nein, daß man ihm hätte Hilfe aufdrängen sollen. Und diese Forderung, verglichen mit dem tatsächlichen Zustand der Welt und ihrem Benehmen Künstlern gegenüber, — ja, die klingt freilich einfach absurd. Und dabei ist doch nichts geschehen. Es hat sich nur der extreme Schulfall des Künstlers gezeigt, dieser Schulfall, den‹ 13 › jedermann gedanklich konstruieren kann, an den jeder schon wiederholt und mit ideologischer Genugtuung gedacht hat, an den man quasi gewöhnt ist. Aber siehe da, er ereignet sich nun wirklich einmal, und sofort reißt sich die ganze Paradoxie unserer Existenzform auf, die Unmöglichkeit, zu leben ...
Es gibt Menschen mit Ellbogen und solche ohne Ellbogen. Das Besondere des Falles Adolf Schreiber war: er hatte nicht nur keine, sondern sogar negative Ellbogen, Ellbogen gegen sich selbst.
Es konnte ihm nichts Widerlicheres geschehen, als wenn man eines seiner Werke lobte. Er geriet dann in nackte Wut. Ich habe dergleichen nie gesehen außer an ihm. — Wohl gibt es eine edle Trauer, Niedergeschlagenheit des Künstlers, der in die Bewunderung, die seine Arbeit erweckt, oft genug nicht mit einstimmen kann, weil er das höhere Ziel sieht, das er verfehlt hat, und niemanden außer ihn bedrückt diese Vision. Diese Trauer also kommt vor, man kennt sie. Aber Wut, aufrichtige, gallige Wut? Ich weiß es, daß Adolf Schreiber oft, wenn ich von seinen Liedern entzückt war und dies aussprach, mich für einen Lügner und Schmeichler gehalten hat. —‹ 14 › Heute, in der Ewigkeit, mein toter Freund, weißt du es, daß ich nie schonen wollte, daß ich nur deshalb und nur dann lobpries, wenn ich mich beschenkt von dir fühlte, lebenserhöht, angefacht, — durchsonnt jede Ader von Glück, das dein junges liebeglühendes Genie gab. Ich habe ja öfters auch ablehnen müssen, namentlich in den späteren Jahren. Die Melodien deiner Jugendwerke aber kamen aus dem Himmel. Er gehörte, wenn du vorspieltest, nicht mehr dir allein, der Zugang war offen, du hattest nichts zu verbieten, nichts dreinzureden, wenn meine Alltagsstarre in Tränen auftaute ... Aber Schreibers Benehmen war derart, daß es einem die aufrichtigste Begeisterung hätte verleiden können. Sogar ich, sein Jugendfreund, fürchtete den endlosen Wortschwall seiner Ableugnungsversuche (er leugnete sein Genie). Ich hielt zuweilen mit meiner Bewunderung zurück, nur um unerquicklichen Debatten über meine „Falschheit“ zu entgehen. Es gab Zeiten, in denen er sich mir ganz verekelte. Denn man fühlte in seiner Ablehnung alles Lobes sehr wohl auch einen ungeheuren inneren Stolz mit. Diese Mischung von äußerer Unterwürfigkeit, Selbstzerfleischung, Sadismus gegen sich selbst und verborgenem Trotz, der zumindest‹ 15 › als Eigensinn immer wieder ausbrach, war äußerst schwer erträglich.
Er bat unaufhörlich jeden, der mit ihm zusammentraf, doch nur ja davon überzeugt zu sein, daß er gar kein Talent habe, daß er den letzten Dreck an Stümperhaftigkeit darstelle ... Die Welt läßt sich so etwas nicht zweimal sagen. Sie ist ja im allgemeinen darauf eingestellt, so oder ähnlich zu urteilen. Sie widersetzte sich ihm nicht, sie tat ihm den Gefallen.
Die „Welt“: damit meine ich aber nicht etwa das volgus profanum. Von dem wäre es selbstverständlich. — Nein, der Fall Schreiber scheint wie darauf angelegt, das Tiefste in bezug auf dieses Verhältnis „Künstler und Kritik“ — „Künstler und Rezeptivität“ zu enthüllen. Denn es waren die feinsten Köpfe Berlins, die ich jedesmal, so oft ich für ein paar Tage nach Berlin kam, auf Adolf Schreiber aufmerksam machte und mit ihm zusammenführte. O wie grenzenlos haben sie mich alle enttäuscht, alle! Obwohl ich es ihnen doch im vorhinein ausführlich dargelegt hatte: „Da ist ein Mensch, absolut ungeschickt — ungeschickt ist schon gar kein Ausdruck für diesen Zustand chronischer Selbstmörderei — ein Quell, den man erbohren muß aus härtestem Fels — aber ich sage euch, der Quell ist da“, — obwohl ich sie also‹ 16 › immer auf all sein koboldhaftes Liebenswürdigsein, seine oft lästige Höflichkeit, seine Verstocktheiten vorbereitete: keiner hat es auf die Dauer ausgehalten, keiner hat an ihn geglaubt. Die Klügsten betrog er durch unaufhörliches Sichselbstzerhacken, die Gütigsten ermüdete er durch seine unter dem Schein des temperamentvollen Zickzackflatterns verborgene Unnachgiebigkeit. Unbegreiflich aber bleibt es mir, daß die, denen er seine Lieder am Ende dennoch vorgespielt hat, von diesen Feuerbränden nicht definitiv entzündet wurden. Man sagt mir nun: Er spielte so schlecht Klavier. Ich habe das nie gefunden (und ich verstehe schon was vom Klavierspielen). Wohl aber weiß ich, daß Adolf Schreiber nie das Klavier angerührt hat, ohne auf die schweinemäßigen Fehler, die er sofort machen würde, im vorhinein zu fluchen. Er machte dann keine. Aber nach dieser Introduktion hörte sie eben jeder. Eines ist wahr: das verschmierende Weglasse-Klavierspiel, das zum modernen Kapellmeister gehört, das verstand er wenig. Es widersprach seiner reinen, auf ehrfurchtsvolle Sauberkeit bedachten Natur. Peinlich rang er darum, jede Note, jede Sechzehntelpause herauszukriegen. Er spielte etwas hart, warf kein Seidennetz über die Tasten, in dem unbequeme Akkorde hätten in‹ 17 › Andeutungen und falsche Schatten wegschlüpfen können ... Dann heißt es, er habe seine eigenen Lieder mit entsetzlicher Stimme gequäkt. Zugegeben; aber der Kenner muß eben diese Eigentümlichkeit so manches Komponisten auf der Stelle ins tönende Silber der Konzertpodien zu transformieren wissen ... O unbegreiflich, daß man nicht aufgehorcht hat, wenn er mit der ganz ehrlichen Liebe des großen Bedürfnisses von den Meistern sprach, die ihn beseligten: von Beethoven, Smetana, Haydn, Brahms, Reger, Bach, von Dauthendey, Flaubert, Rilke. Er sprach von ihnen, wie man von Wohltätern, von Almosengebern, vom täglichen Brot, von Atemluft spricht. Er brauchte sie um ihrer selbst und um seiner natürlichen Beschaffenheit willen, er war auf sie angewiesen, er lechzte nach Schönheit und er sättigte sich an ihr. Ist denn solche Liebe, solche Lauterkeit und Demut allzu häufig? Mir ist sie drei-, viermal begegnet im ganzen. Sie mußte jeden erschüttern, sie brach so rückhaltslos, so nebenzwecklos, so geradehin aus Schreibers großem, stets erstaunt lächelndem Blick! — Aber niemand sah es, niemand hat diesen Blick zurückgestrahlt.
Die Fremdheit, mit der Menschen einander begegnen, die nicht gerade Freunde oder Liebende‹ 18 › sind, ist erstaunlich. So oft ich aus meinem Gehäuse Prag hervorkrieche und ein paar Tage in Berlin verbringe, fällt mir das auf. Gerade in Berlin fällt es mir besonders stark auf, in den Kreisen der Künstler und des Kunstbetriebs. In Berlin geht nämlich alles Äußerliche so glatt vor sich, das erleichtert das Leben ganz ungemein. Die täglichen Lästigkeiten, die Friktionen des schlechtfunktionierenden Tintenfasses, des verbrauchten Löschblattes fehlen. Rhythmus erfaßt auch den Unfähigen, den Faulen, den Schlemihl. Plötzlich strahlt er von Tüchtigkeiten, praktischen Zeiteinteilungen. Man hat nie Zeit, infolgedessen hat man für das Wichtige immer Zeit. Bei den Schaltern gibt’s kein Gedränge, denn das Publikum stellt sich von selbst ohne Schutzmann im Gänsemarsch von der richtigen Seite an. Trinkgeld-Meditieren ist abgeschafft. Jede Wohnung: Warmwasser, Balkon — was denn! ihre Loggia!! Selbst die mondlichtdünnste Unternehmung stützt sich auf strammes Briefpapier, Bernhard-Type, ganz fette, durch zittrigen Rand über sich selbst hinausgreifende Lettern und Unterstreichungen nie weniger dick als eine Schriftzeile. Der ingeniöse Fünfzack als Punkt, anders geht’s schon nicht —, das flößt unbewußt Vertrauen ein. Wird etwas gegründet,‹ 19 › wozu anderwärts noch nach Monaten nicht mehr als ein Witz an Aktienkapital bereit steht, eine auf den ersten Blick lebensunfähige, weltfern blaguierende Literatenidee, eine Qualle, scheinbar nur im Aroma des Kaffeehauses haltbar, — hier tritt sofort ein wetterhartes Plakat, künstlerisch aufgemacht, in die Erscheinung, verwandte Farben (orange in gelb, violett in schwarz) werfen ihr Pathos ineinander, daß es nur so kracht, „Steinplatz“ oder „Pfalzburg“ sind um eine neue Telephonnummer bereichert und, was das Merkwürdigste ist, die Sache lebt wirklich, fügt sich ein in die Welt der Dividende. — Infolgedessen fühlt man sich angenehm gespannt, aufgepulvert, frei, gleichsam ohne Handgepäck, jedermann tritt gutgeölt in den Tag, sogar Unterernährte haben eine fröhliche Gesichtsfarbe — und so ist denn der erste Eindruck der eines schnellen freundlichen Entgegenkommens. Von Kälte habe ich nichts gespürt. Was einer zu geben hat, wird rasch erkannt, in Empfang genommen, umgesetzt. Querköpfigkeit, unnütze Reibung fehlt. So sollte man also glauben, daß hier präzise Bahnen für jedermann geöffnet sind. Und doch ist dieser erste Eindruck falsch. Die Glätte der äußeren Abwicklung erleichtert inneres Anknüpfen, aber bis zu einem gewissen‹ 20 › Grade nur. Dann stößt man auf eine Asbest- und Aschenschicht, nicht zu durchdringen. Dann rollt das Rad, mit dem sich’s so hübsch im Takt rollen ließ, über einen hinweg. Der zur guten Stundeneinteilung skelettierte Tag kommt den leichteren Problemen der Geistigkeit sehr entgegen, vor den schwereren versagt er. Da, wo es heißt, stundenlang, tagelang auf einem Fleck stehn und grübeln, da versagt er. Das leichte, wohlabgestaubte, spiegelklar registrierte, mit Telephon und Schaltbrett, Lauf-Pagen, Anmeldung usf. mustergültig versehene große literarische Bureau „Berlin“, in seinen besseren Abteilungen auf wirkliche Wertigkeit eingestellt, der besondern Nüance nicht abgeneigt, manchen Bluff durchschauend, manche Mache ablehnend, mit anständiger Klarheit richtig bemüht, — da, wo man sich die Haare raufen muß vor Entzücken, wo man leidenschaftlich nicht nur die doppelte oder dreifache, schon sehr zuvorkommend bemessene Konferenzzeit, sondern eventuell die ganze Zeit von der Schöpfung der Erdkugel bis zum Weltuntergang hingeben müßte, ja, da kann es nicht mehr mitmachen. Bei Adolf Schreiber konnte es nicht mitmachen. Es war durchaus naturnotwendig (das sehe ich jetzt ein), daß in Berlin Adolf Schreiber untergehen‹ 21 › mußte. Berlin und Adolf Schreiber: das waren absolute Gegensätze. In Berlin sind selbst ganz bizarre Originale von Künstlern lebensfähig, — die wohltuend praktischen Einrichtungen der Druckereien, Adreßbücher, Untergrundbahnen, Klosette u. ä. kommen ihnen entgegen; in andern Städten ergattert man ja nie, was man braucht, es bedarf da Cecil-Rhodesscher Findigkeit und Unternehmungslust, um nur an ein Waschlavoir zu gelangen — und in Berlin wird selbst Schrullenhaftigkeit irgendwie verwertet, allenfalls in Sensation umgedeutet, auch der abseitige Einfall muß nicht auf „Notierung gestrichen“ sinken, weil man eben kraft vernünftiger Lebensführung für den Genuß einer gewissen rationierten Genialität Zeit behält, in Berlin ist also alles trefflich eingerichtet und selbst das Unpassende findet seine Unterkunft — bis zu einem gewissen Grade. Adolf Schreiber aber war gradlos, er war das Nirgendshineinpassende an sich, das Prinzip der Untüchtigkeit in Reinkultur. Ihm bis zu einem gewissen Grade entgegenkommen, hieß: ihm überhaupt nicht entgegenkommen. Er hätte Jahrhunderte gebraucht, um (als Mensch) verstanden zu werden. So riß allen die Geduld, auch solchen, die selbst komplizierte Fälle sind und die sich nur mit Mühe aufrechterhalten, die‹ 22 › in jeder andern Stadt untergehen würden außer in Berlin, das wenigstens eine rationierte Geduld hat, immerhin mehr Geduld mit seinen Künstlern als irgendeine andere Stadt, die ich kenne. Berlin, das ich liebe, mit dem ich persönlich ganz gut auskomme, denn einen kleinen Puff Fremdheit (wenn auch nicht zu viel) halte ich eben aus ... Wenn nun aber ein Mensch wie Adolf Schreiber das Unglück hat, daß er vollständig durch und durch aus jener elysischen südwindzarten Lauterkeits-Materie besteht, von der wir Hyperboräer glücklicherweise nur einen Teil mitbekommen haben! — Nicht die Technik der Großstadt hat Adolf Schreiber umgebracht. Die Technik bringt den Geist nicht um. Sie erleichtert sogar sein Leben bis zu einem gewissen Grade. Aber dieses „bis zu einem gewissen Grade“ hat ihn umgebracht. Es konstituiert die Fremdheit zwischen den Menschen. Unter dem Schild erleichterter geistiger Kommunikation, komfortabler Bureaumöbel, schnellen Einverständnisses, das aber nur für robuste Naturen oder für das robuste Teil zarter Naturen gültig ist, unter dem Schein expeditiver Arbeitsmethodik schafft dieses „bis zu einem gewissen Grade“ den besten Wert männlichen Verkehrs ab: die wahre, grenzenlose, bis dort hinaus zeitverschwenderische Freundschaft.
‹ 23 ›
Vor mir liegt ein alter Brief Ludwig Rubiners: „Lieber Herr Brod! Ich war neulich bei Adolf Schreiber. Die Sache kommt mir bald hoffnungslos vor. Denn er setzt seine fürchterliche Selbstzerfleischung und Verachtung ja nicht einmal mehr in künstlerische Form um. Nun betreibt er schon soundso lange bei einem alten Idioten Kontrapunkt, natürlich nur, weil der Mensch seine Lieder schlecht findet! Neulich war er beim Kapellmeister Reznicek, der ihm offenbar viel Gutes gesagt hat. Infolgedessen hat er mir lediglich wiedererzählt, wie R. feststellte, daß Schreibers Lage hoffnungslos sei. Ein hoher Genuß war es vor einigen Tagen für ihn, als er einen Hundertmarkschein aus der Tasche verlor — seine Produktivität wurde kolossal angeregt ... Da sich aber dieser ganze Masochismus (ein leider allzu billiger Begriff!) bei ihm nur in mündlichen Beteuerungen ausdrückt, also wie beim Komponisten ein bloßes Phantasieren auf dem Klavier ohne Niederschrift — so erscheint mir die Sache hoffnungslos.“ — Wie treffend ist hier alles Äußere gesehen. Und doch ist der treffliche Psycholog hinters Licht geführt. Denn Schreiber pflegte künstlerische Lethargie vorzutäuschen. Das war einer seiner Tricks, um die Menschen von sich abzustoßen ... Ich greife‹ 24 › einen beliebigen seiner zahllosen Briefe an mich heraus. Da heißt es: „Du glaubst vielleicht, ich wollte Dich kränken, habe Launen oder wünsche den Himmel herabzureißen. — Nein, nein, nur ein bißchen Talent möchte ich haben und wollte schon zufrieden sein und glücklich, aber so ist das Leben schier unerträglich, allen zur Qual und mir zur unerträglichen Last, die ich abschütteln möchte. — Ich weiß, Du bist großmütig und wirst von einem Bruch zwischen uns beiden nichts hören wollen — aber was nützt die Verzweiflung — ich kann nicht mit!“ ... So suchte er mir immer einzureden, daß er mein Leben unnütz belaste, mir Mühe verursache usf. Indes war ich von Dankbarkeit für seinen „verlorenen Schwimmer“, für „Fastnacht“, „Si dormis“ und andere Lieder immer aufs neue durchglüht. War nun ich verrückt oder war er es? Seiner Beredsamkeit standzuhalten war nicht leicht. Er brachte immer neue Argumente vor, wollte seinen Unwert dem Widerstrebendsten nachweisen. Man mußte sich da immer wieder vorhalten: das ist doch derselbe, der ...
Daß nun gerade ich die Geduld nicht verloren habe, rechne ich mir nicht als besonderes Verdienst. Schreiber war mein Jugendfreund, unter all meinen Freunden der frühest erworbene. Das bindet.
‹ 25 ›
Ich hatte ihn kennen gelernt, als er dreizehn Jahre alt geworden war, bei seiner Barmizwah. Ich stand damals im zwölften — 1896.
Adolf Schreibers Vater und der meine sind in demselben Haus der Prager Josefsstadt (Euphemismus für „Judenstadt“) aufgewachsen. Mein Vater machte die Bankkarriere, Schreibers Vater wurde Tapezierermeister. — Ich rekonstruiere nachträglich, daß das Erscheinen der gesamten Familie Brod bei dem Familienfest Schreiber als eine Art „Ehrung“ des arm gebliebenen Jugendgespielen gedacht war. Jedenfalls kam ich damals zum erstenmal in das bescheidene Häuschen Altprags (wir wohnten schon längst in der Neustadt). Nach der üblichen Konfirmationsrede spielte der kleine Adolf ein wenig Violine. Das entschied. Denn auch ich war damals schon eifriger Musikant, Klavierist. Wir beiden Kinder tauschten unsere Erfahrungen und Wünsche aus, jenseits aller sozialen Schichtungen, von denen wir ohnedies nur Schattenhaftes ahnten.
Dieses erste Zusammentreffen hat sich so klar in mein sonst schlechtes Gedächtnis gestanzt, daß ich mich sogar noch des Likörs entsinne, der damals herumgereicht wurde ... Das Häuschen der Castulusgasse aber ist längst eingerissen. Ich kann die Stelle nicht finden, wo es gestanden hat.
‹ 26 ›
Adolf wurde eingeladen, uns zu besuchen. Er kam, samt der Violine. — Diese ersten Besuche zeitigten in Keimanlage gleich das ganze künftige Verhältnis zwischen den Freunden, ja Adolfs ganze Lebenseinstellung. Er war furchtbar schüchtern, von einer trotzigen peinlichen Schüchternheit. Es dauerte jedesmal buchstäblich stundenlang, ehe es meiner Mutter gelang, ihn zum Kaffeetrinken zu bewegen. Die Grazie, etwas als Selbstverständlichkeit anzunehmen, hat er nie besessen. Dieses Kaffeetrinken brachte quälende Debatten hervor, manchmal schon recht bösgemeinte Scherzhaftigkeiten, die mich rasend machten, denn ich drängte doch schon zum Musizieren. — Schrecklich war mir auch die Verehrung, die Adolf meinem Gymnasialstudium, meiner besseren Orthographie (was er „Bildung“ nannte) entgegenbrachte. In musikalischer Entwicklung war er mir voraus, was er aber nie anerkennen wollte.
Wir spielten vierhändig, auch Klavier und Violine. Überdies waren wir völlig uns selbst überlassen. Ohne Führer schlugen wir uns auf eigene Faust durch das Dickicht der ersten Kunstbegeisterungen. Dabei gab es natürlich manches Komische. So fiel uns beispielsweise eine bloße Violinstimme des Mendelssohnschen Konzertes in die Hände. Wir glaubten fest und steif, daß‹ 27 › diese Stimme das ganze Werk bedeute, — daß es anders sein könne, auf diese Idee kamen wir gar nicht. Adolf mußte mir nun immer wieder das Konzert in dieser Form vortragen, es bezauberte uns völlig. Frei, ahnungsvoll, vieldeutig schwebte der Faden der reinen Melodie über dem Abgrund ... Nun gaben wir von Zeit zu Zeit unglückseligen Verwandten eine Vorführung, eine Probe unseres fortschreitenden Könnens. Hauptnummer: Mendelssohn-Konzert für Violine solo. Heute erscheint es mir freilich nicht mehr so empörenswert wie damals, daß die Zuhörer dem dünnen Lineament der einen Stimme nicht zu folgen vermochten, daß sie sich langweilten, zu schwätzen begannen. O diese Wut gegen die Philister in unsern jungen Herzen! Meine Entrüstung, als es hieß: „Er hat entsetzlich gekratzt. Es ist zu schwere Musik u. a.“ ... Eines aber ist seltsam: als ich in späteren Jahren zum erstenmal die Klavierbegleitung des geliebten Konzertes hörte, war ich bitter enttäuscht. Die Harmonien, die wir hinzuimaginiert hatten, waren so mystisch schön gewesen.
Wir waren auf Zufälle angewiesen. Ich entsinne mich eines Nachmittags, da uns die vierhändig gespielte Ouvertüre „Der Kalif von Bagdad“ (Boieldieu) faszinierte. Eine Stelle, die mir‹ 28 › heute ganz gleichgültig erscheint, erregte damals unsere ganze Glut. (Es ist der 37. bis 32. Takt, vom Schluß aus gezählt, — offenbar stießen wir auf diese Akkordfolge zum erstenmal.) Immer wieder spielten wir diese eine Stelle und immer lauter. Wir schrien vor Vergnügen, wir sangen mit. Wir spielten die ganze Ouvertüre von vorn, um uns nochmals überraschen zu lassen, um die ganze Süßigkeit auszunutschen. Wir überboten uns in den hartnäckigen Ausrufen: „Jetzt aber noch einmal!“ Als die Eltern heimkamen, fieberten wir beide. Adolf wurde schnell heimgeschickt und ich ins Bett.
Niemand nahm sich unseres Geschmackes an. Wir bildeten eigene, sehr primitive Terminologien. Das höchste Prinzip unserer Verehrung hieß „Dissonanz“. Der Dreiklang galt als verflucht. Inbegriff aller Lächerlichkeit war Weber. Wagner überstrahlte bald alles. — Wollten wir etwas als äußerst geschmacklos und banal bezeichnen, so lachten wir höhnisch: „Preziosa-Ouverture“. Das war der Nullpunkt der Musikalität. — Wir haben später unsere Ansichten mehr als einmal revidieren müssen. Namentlich Adolf schwärmte dann für die einfachsten Formen, für Mozart und Haydn. In diesen Bezirk konnte ich ihm nicht folgen. Ich gestehe, daß‹ 29 › mir noch heute von allen musikalischen Klassikern Weber der am wenigsten zugängliche ist.
Unser Taschengeld sparten wir in einer kleinen Holzkassette. War sie voll, so wurden aus diesem Schatz Sonaten für Klavier und Violine gekauft. Die Klavierstimmen lagerten bei mir, die Violinstimmen bei Adolf. Dieser gemeinsame Besitz an Viotti, Spohr, Vieuxtemps, Beethoven u. a. war unser Freundschaftstolz. Einmal aber war schon Teilung proponiert. Die Freundschaft sollte gekündigt werden, und zwar aus „nationalen Gründen“. Der kleine Adolf wurde an einer tschechischen Bürgerschule, ich im deutschen Gymnasium erzogen. Der chauvinistische Geist der Schulen wirkte. So fühlte sich Adolf als fanatischer Tscheche, ich als erbitterter Minoritätsdeutscher. Es kamen die Dezemberkrawalle 1897, nach dem Sturz Badenis schlug der Pöbel allen Deutschen und Juden die Fenster ein. Auch in meiner Elternwohnung splitterten nachts die Scheiben, bebend flüchteten wir aus dem gassenwärts gelegenen Kinderzimmer ins Schlafzimmer der Eltern. Ich sehe noch, wie mein Vater die kleine Schwester aus dem Bett hebt — und am Morgen lag wirklich im Bett ein großer Pflasterstein. Mit einem Bügelbrett wurde das Hoffenster verbarrikadiert. Aber wir schlossen kein Auge.‹ 30 › Welche Beruhigung endlich für die ängstlichen Kinderherzen, als der feste Schritt des Militärs draußen die Straße räumte ... Am nächsten Morgen führte ich meinen Freund vor die verwüstete Fassade, erzählte ihm alles, forderte ihn auf, angesichts dieser „Barbarei“ sein Tschechentum abzuschwören — oder es sei alles aus zwischen uns. Er gab aber nicht nach. Zum soundsovielten Mal kam es nur zu unserem heißen Kindergespräch über Recht und Unrecht ... Nach vorübergehender Abkühlung unserer Freundschaft scheint uns indes der gute Genius der Musik bald wieder zusammengeführt zu haben.
Viele Jahre darauf merkten wir beide, obwohl in Häusern ohne jüdische Tradition aufgewachsen, wohin wir gehörten. Von unsern Kindheitsnationalismen blieb, uns beiden gemeinsam, die Liebe zur deutschen wie zur tschechischen Musik; da gab es dann keinen Streit mehr. — Adolf Schreiber war völlig unpolitisch. An meinen kulturellen Interessen (z. B. dem „Jüdischen Volksheim“ in Berlin) nahm er einigen Anteil. Wie tief aber das Judentum in ihm saß, auch ohne Wissensfundierung, entnehme ich jetzt bei Sichtung aller Erinnerungen (zu meinem Erstaunen) einer alten Briefstelle: „Den Versöhnungstag habe ich heuer das erstemal in meinem Leben —‹ 31 › menschenwürdig verbracht — ich habe über die Zerstörung des Tempels geweint. — Muß das eine furchtbare Katastrophe gewesen sein. — Bei der Zerstörung ist jedem persönlich ein Leid zugefügt worden, ein unerreichbares Ideal ist vernichtet worden — Männer und Frauen weinen auf der Straße — können kaum mehr gehen — einer erzählt dem andern — die Kinder schreien und weinen, daß ihre Eltern nicht zu Hause sind — daß sie nicht zu essen bekommen, aber diese denken nicht an Speise und Trank — sie fühlen nur den Schmerz und Verlust — alles vergißt zu essen, zu leben. — Und wir Elende — was ist uns Hekuba — wir feiern diesen Tag mit Fasten — wir entsagen der Speise — bewußt — hungern und dürsten — wie bewußt!!! und beten für unser Wohlgedeihen.“ — — —
Schon die Tage der Kindheit schwächten meinen Freund durch allzu böse Kämpfe. Er sollte Handwerker werden. Endlich setzte er es durch, ans Konservatorium zu kommen. Zuerst in die Violinschule. Dann kostete es wieder große Anstrengungen, in die Kapellmeisterklasse unter Dvořák übernommen zu werden. — Er plagte sich mit Violinstunden. Eine Zeitlang war auch ich sein Schüler. Und da zeigte sich die andere Seite seines Wesens. Er sekierte mich entsetzlich.‹ 32 › Klavier hatte ich leicht erlernt; mit dem Violinspiel ging es nicht vorwärts. Mit Grauen denke ich an die erfolglosen unendlichen Lektionen zurück. Aus jeder Kleinigkeit machte Adolf eine Affäre, über Hand- und Armstellung, Bogenhaltung usf. kam man monatelang nicht hinaus, besonders schmerzhafte Griffe mußten besonders oft wiederholt werden, bis alle Gelenke krachten — Niedersitzen, wenn die Beine zitterten, war nicht erlaubt, nicht fünf Minuten der langen Stunde ließ er sich abhandeln, gab lieber noch zu. Dabei immer dieses höflich-höhnische, geradezu erfreute Lächeln im Gesicht des grausamen Lehrers. Spartaner gegen sich selbst, war er es auch gegen andere. In konniventester Form folterte er, und es war manchmal das Nebensächlichste, worauf er bestand. — Er mochte dem Gotte der Kunst nur unter Qualen dienen. Man kann sich vorstellen, wie das in seinen Provinz-Operetten-Ensembles gewirkt haben mag.
Denn das ist ja die Tragik in seinem Leben: er, der Philisterhasser, der glühend in sich verschlossene Verächter alles Mittelmäßigen und Niedrigen, hochgespanntester Empfangsapparat für die äußersten schwierigsten keusch-ernsthaftesten Wellenlängen der Kunst und Kunstmoral,‹ 33 › mußte Zeit seines Kapellmeister-Daseins der Operette dienen.
Hier ist der Ort, gegen einen der furchtbarsten sozialen Mißstände zu protestieren, der tief ins Kunstleben eingreift. — Ein Kapellmeister, der vom Geld seiner Eltern lebt, kann als Volontär oder Korrepetitor an eine große Opernbühne gehen, wo er dann allmählich zum Dirigenten aufrückt oder wenigstens die Anwartschaft auf den Kapellmeisterstab eines andern wesentlich künstlerischen Instituts erringt. Adolf Schreiber war so arm, daß er vom Konservatorium weg ins Verdienen mußte. Die mehrjährige Schonzeit war ihm versagt. Das erstbeste Engagement an eine Schmiere war ihm recht, denn auch um dieses hatte er lange genug zu kämpfen. Wer nun aber hofft, aus der für Unbemittelte notgedrungenen Anfänger-Schmierenlaufbahn jemals in die Sphäre erstrangiger Kunst sich emporarbeiten zu können, der irrt ganz gewaltig! Adolf Schreiber war nun einmal bei den Theateragenten als Operettenkapellmeister abgestempelt — und so blieb er es sein Leben lang, trotz verzweifelter Versuche, an ein kleines, aber anständiges Stadttheater zu gelangen. Lebenslänglich verurteilt zur Geschäftsbühne, zur Polyhymnia des Profits, nie vor eine vollwertige‹ 34 › Kunstaufgabe gestellt. Und das alles nur, weil das Geld fehlte, ein paar minderbesoldete Saisons einzulegen. Deshalb also dirigierte Abend für Abend der scheue Erdengast im „Theater des Westens“ den „fidelen Bauer“ oder die „Dollarprinzessin“. — O, wie die Schablone arbeitet, die Diktatur des „Faches“, mag es noch so sehr wider Anlage und Willen gewählt sein. — Wie oft hat Schreiber den Versuch gemacht, aus dem Bannkreis der Amüsiermusik auszuspringen! Ein würdigerer Arbeitskreis hätte zweifellos manche seiner inneren Disharmonien geschlichtet. Wer weiß, vielleicht wäre er im Opernstudium oder mit guter Symphoniemusik beschäftigt, also in den oberen Rängen des Metiers, auch seiner Selbst-Unzufriedenheit, seines Minderwertigkeitsgefühls Herr geworden! Wie freute er sich, wenn er nur einmal dazukam, richtige gesundgewachsene Partituren zu schlagen, sei es auch nur eine der älteren Operetten (Suppé oder Millöcker, Strauß) mit ihrer immerhin feineren Faktur, ihren wohlgebauten Ouvertüren und Finalesätzen, mit welcher Gründlichkeit und Feuerkraft warf er sich auf die ihm so seltene Aufgabe! Aber das waren nur vorüberfliegende Sterne. Der Horizont, der ihn dann immer wieder einschloß,‹ 35 › hieß: Vaudeville. Aus dieser traurigen „Lustigkeit“ gab es für den so tödlich ernsten, fast humorlosen Menschen kein Entrinnen.
Einmal lächelte das Glück. In Kronstadt sagte bei einer Lohengrin-Aufführung der erste Kapellmeister ab. Ich zitiere (o armes Dokument eines erfolglosen Lebens) die „Kronstädter Zeitung“:
„Der Aufführung des gewaltigen Wagnerwerkes ‚Lohengrin‘ sahen wir gestern mit geteilten Gefühlen entgegen. Einesteils bangte uns davor, ob wohl der Aufführung sich nicht so viele technische Schwierigkeiten entgegenstellen werden, daß der Gesamteindruck erheblichen Schaden leiden müsse, andernteils freuten wir uns auf die herrliche Musik. Unser Bangen wuchs, als vor Beginn der Aufführung Herr Chlumetzky vor die Rampe trat und dem Publikum mitteilte, Herr Kapellmeister Heß sei plötzlich ziemlich schwer erkrankt und es werde der zweite Kapellmeister Herr Schreiber die Oper dirigieren. Es schien uns, als hätte Herr Heß bei den Proben den Eindruck gewonnen, die Oper gehe nicht und habe aus dem Grund die Leitung nicht übernommen. Dann erschien Kapellmeister Schreiber und siehe, schon‹ 36 › nach den ersten Takten des Orchesters kam eine Beruhigung über uns, wir sahen, daß Herr Schreiber mit Energie und Sicherheit den Taktstock schwang. Und so blieb es bis zum Schluß. Wir müssen es gestehen, daß uns die Aufführung förmlich überrascht hat. Es war vielleicht die beste, die wir heuer gehabt haben usf.“
Daß der glückliche Zufall im Leben dieses Pechvogels keine weiteren Konsequenzen gehabt hat, ist selbstverständlich. Nachzudrücken, wo etwas nicht ganz von selbst ging: das verstand er nicht. Ich finde in seinen nachgelassenen Papieren nur noch einige Theaterzettel („Hoffmanns Erzählungen“, „Figaros Hochzeit“), die ihn als Operndirigenten zeigen. In eben diesem Nachlaß das Programm seines Benefizabends im Stadttheater Bozen: es bringt das Vorspiel zu den Meistersingern, eine Arie aus der „Entführung“, Balladen von Loewe und Haydns Abschiedssymphonie. Eine lichtere Zeit verbrachte er an der „Neuen Opernschule“ von Mary Hahn (Berlin). Unter seiner musikalischen Leitung gab es Richard-Strauß-Abende, einen Wagner-Abend, Szenen aus Glucks „Orpheus“. Wo er selbständig arbeiten konnte, bewährte er sofort erlesenen Geschmack. Eine Saison‹ 37 › lang war er Korrepetitor am Deutschen Opernhaus in Charlottenburg. Künstler wie Hansen, die Stolzenberg schätzten ihn sehr. Aber da er den ganzen Tag über Proben, abends Bühnendienst hatte, von 100 Mark monatlich aber bei Verzicht auf alle Nebeneinnahmen (Gesangsstunden) nicht leben konnte, mußte er immer wieder Stellen von besser atembarer Musikatmosphäre aufgeben. Volle Einnahmen brachte nur die Operette, ruhiges Aufdienen in bessere Opernposten hätte zuviel Zeit beansprucht, so blieb es für Söhne reicherer Häuser reserviert.
Mein unglücklicher Freund walzte so ziemlich über alle niederen Kunststätten Deutschlands und Österreichs hin. Zuerst Linz, Tilsit, Ingolstadt, Pilsen, Eger, Hermannstadt, Prager Sommertheater, Bozen, — dann Hamburg unter Direktor Monti — 1906 zuerst im „Theater des Westens“, dann unter Palfi im „Neuen Operettentheater“ am Schiffbauerdamm — die Odyssee einer Operettengesellschaft über Aachen, Halle, Hannover u. a. — dann Krankheitspause. Im Krieg sechs Wochen lang Soldat, ja auch diese Tragikomödie fehlte nicht. Dann kam er frei, zu Fronttheatern im Westen, wo er Lille, Cambrai, Valenciennes, Longwy, später im Osten Minsk mit Foxtrott und Dreivierteltakt nebst entsprechendem Bühnenvorgang‹ 38 › zu beglücken hatte. Der Frieden brachte ihm nur eine neue Tournee, Harz, Spandau, die kleinen Orte der Mark. Die Truppe hatte nicht etwa ein Orchester mit sich. Überall spielte er dasselbe Stück mit neuen Musikern, Dorfmusikanten oder Stadtkapelle. Eine einzige Probe, dann die Vorstellung. Nach zwei, drei Tagen weiter ... Dazu also hatte eine schöne Jugend die geheimsten Herzsaiten zu den wählerischesten Klängen sorgfältig gestimmt! Dies der Ausgang vieler groß-hingebauter Pläne, unter Nachtwachen überwundener Hemmnisse, Neugeburten. Unter der Last des ihm aufgezwungenen Schlendrians brach er fast zusammen. — Die letzte Anstellung war wieder bei Palfi, im „Künstlertheater“. Doch davon später!
Ich blättere in deinen alten Briefen, mein Guter. — Damals, als es noch nicht klar war, daß dieser Ring sich unzerbrechlich schließen würde um ihn, gab er sich auch der niederen Muse mit Straffheit und Respekt hin. In einem schönen Brief erklärt er mir, wie auch eine Schundoperette gut dirigiert werden könne, wie z. B. der Rhythmus stets ins Absolute greife, wenn man ihn nur richtig herausbringt. Die ganze Kraft der Jugendanfänge spricht aus solchen Theorien. Unglück, Selbstanklage beschäftigte‹ 39 › ihn auch damals schon genug, — aber doch immer wieder auch ein frischer Antrieb, ein heiter Sinnliches, das später ganz fortfiel. Die Ferne war in schönem, perlenfarbigem Nebel unendlich, Morgenlüfte wehten auf über dem Tau, — am köstlichsten wohl im Jahre des Pilsner Erlebnisses und der Wiener Tage. Ein oder zwei Jahre darauf besuchte ich ihn in Berlin. Es muß um 1906 gewesen sein. Wir hatten einander eine ganze Zeitlang nicht gesehen. Mein erstes Buch war (unter lebhaftester Anteilnahme des Freundes) eben erschienen. — Da zeigte er mir seine ersten Lieder, sehnsüchtige Erinnerungen an seine einzige große Liebe, an die „Rekonvaleszentin“, an Wien. Diese Stunde war eines der markdurchdringenden, gleichsam imprägnierenden Ereignisse meines Lebens. Damals fühlte ich, daß Adolf Schreiber ein Genie ist. Ich habe an dieser Erkenntnis festgehalten gegen alle Kohorten sogenannter „Sachverständigen“ und „Elitemenschen“, ja gegen ihn selbst. Und ich werde an dieser Erkenntnis bis zu meinem Tod festhalten, sie ist einfach ein Bestandstück meiner Seele, unwiderlegbar. — Die vorliegende erste Ausgabe Schreiberscher Lieder wird mir überdies, das weiß ich, Bundesgenossen schaffen. — Auch um Gustav Mahler habe ich‹ 40 › ja anfänglich völlig einsam gekämpft, bis zum Krampf manchmal. Und wer kennt noch heute den großen Dänen-Musiker Carl Nielsen, oder den säkularen Tschechen Janáček, dessen „Jenufa“ man einmal neben „Carmen“ und „Aida“ stellen wird! Wer kennt sie, auf die ich seit Jahren hinweise! Aber die Welt ist taub, in ihrer Tücke bringt sie sich selbst um die schönsten Genüsse! Das Erstaunliche dabei ist ja nur, daß sie zu guter Letzt, nach einer Reihe von Jahren oder Jahrzehnten doch immer noch von ihrer fallweisen Taubheit geheilt wird ...
O die kleine Stube damals, das schwarze Leih-Pianino, — wohin versank die Nüchternheit des „Gartenhauses“, nackte Fassade hinter dem Hof mit Staub-Grasbeeten, sauber chamotte-umrahmt! — Schreiber spielte die „Rekonvaleszentin“ nach Worten Peter Altenbergs. Süße Schauer überjagten mich, ich brach in Tränen aus. — Noch heute halte ich dieses Lied für eines seiner Meisterstücke. Diese gut ausgelüfteten, staubfreien Harmonien überall, — spürte man nicht weißlackierte Möbel des Krankenzimmers, linnengekleidete Schwester, ein Fenster groß, offen, und weiche, klare, verzehrend-schmeichlerische Frühlingsluft ... wie märzhaft jung bogen sich in jedem Takt, gleichsam ungewollt, zarte Abweichungen‹ 41 › vom Gewöhnlichen, alles so natürlich und doch neu, ohne irgendwelche Exzessivität neu ... der fast sich von selbst ergebende Fluß der Melodie, sprechend und gesungen zugleich ... und dann wie es sich sammelte von den Worten an: „Ein Abglanz ihrer Leiden“ ... Die beiden Takte von der „halbverwischten Kinderträne“ für sich allein eine Intuition der allerhöchsten Art ... und wie es schloß, wie es fiel und stieg. Wahrlich, wer von diesem Lied nicht hingerissen wird, der weiß nichts vom Glück, nichts von den tiefsten Instinkten der tönenden Welt. — Das Lied gehört überdies zu den wenigen, die selbst dem ungnädigen Schöpfer einige Zustimmung ablockten. Trotzdem brüllte er mehr als einmal wilde Flüche, schwor, es zu vernichten. Da seine Schaffenskraft erstorben sei, habe es keinen Zweck mehr, altes Zeug aufzuheben. In seinem Nachlaß hat sich denn auch keine Abschrift dieses Opus vorgefunden. Es existiert nur in dem einen Exemplar, das ich ihm vor Jahren abgebettelt habe. — Wohl aber fand ich unter Schreibers Papieren einen Brief Peter Altenbergs, in der bekannten Schul-Kurrentschrift, folgenden Inhalts:
„Sehr geehrter Herr, Marya Delward wird, falls es Ihnen recht ist, im Cabaret ‚Fledermaus‘,‹ 42 › Eröffnung 1. Oktober, Ihre feine Sache singen.
Ergebenst und dankend
Peter Altenberg.
·|· Selbstverständlich gestatte ich die Herausgabe meines Textes.“
Ob es zur Aufführung gekommen ist, weiß ich nicht. Eher nein als ja. Alle derartigen Dinge pflegten für Schreiber fehlzuschlagen.
Es wäre sinnlos, die ganze ermüdende Reihe meiner Anstrengungen hier anzuführen. Bei Verlegern, Sängerinnen, Konzertdirektionen, Kritikern, Essaisten pochte ich an. Alles vergebens. Ärgerlich war nur, daß Schreiber selbst mir manchmal im entscheidenden Moment in den Arm fiel, einen wichtigen Weg nicht machte, den ich ihm von Prag nach Berlin hinübertelegraphierte u. ä. — Einmal war (ohne mein Dazutun diesmal) eine Verbindung mit Humperdinck hergestellt. Schreiber suchte ihn endlich auf, er wollte Stunden nehmen. (Er behauptete immer, technisch unausgebildet zu sein.) Humperdinck sah Schreibers Lieder durch. „Sie brauchen keinen Unterricht,“ sagte er dann. (Ehrt ihn in meinen Augen.) Dies war für Schreiber das Signal, überhaupt nicht mehr hinzugehen. Trotz Aufforderung.‹ 43 › Weil der Mann ihn gelobt hatte. Sich unterstanden hatte, ihn, ihn zu loben ...
Dagegen fand er einen alten Schulfuchs, der ihn in „reinem Satz“ und „strengem Kontrapunkt“ zu unterrichten begann. — Wäre die Figur Adolf Schreibers erfunden: diesen Gipfelpunkt der Selbstzerstörung hätte kein Dichter erfinden können, es sei denn Shakespeare selbst oder Dostojewski! Schreiber begann nämlich, unter der Anleitung des trefflichen Lehrers, seine früheren Kompositionen zu „korrigieren“. Er wütete gegen seine eigene Unberührtheit und Genialität. Nun hatte er ja endlich einen gefunden, der im Einklang mit ihm alles, was geschaffen vorlag, verurteilte. Schreiber hatte eine unbegrenzte Verehrung für die Kritik dieses Mannes, den ich nicht kenne, der mir aber von mehreren Seiten als Pedant der allerkonservativsten Schule geschildert wird... So finden sich in allen Arbeiten Schreibers unzählige Bleistiftkorrekturen. Ich habe, wo immer es anging, die ursprüngliche Fassung gewählt und ich glaube, auch spätere Publikationen werden mehr oder minder auf die ersten Niederschriften zurückgreifen müssen. Hier ist freilich der „Textkritik“ eine nahezu unlösbare Aufgabe gestellt!
Adolf Schreiber hat meiner Ansicht nach die‹ 44 › Leistungen seines Lebensfrühlings in späteren Jahren nie wieder ganz erreicht. Ein Talent, gegen das aus allen Leibes- und Seelenkräften gewütet wird, kann nicht anders als degenerieren. Dennoch hat er ein reiches Lebenswerk hinterlassen. Ganze Stöße dieser Kompositionen aus den guten Jahren liegen vor. Nur des beschränkten Raumes wegen mußten einige meiner Lieblinge in der gleichzeitig erscheinenden Liederauswahl wegbleiben. Dazu kommt vieles aus späterer Zeit, das ich noch gar nicht erschöpfend beurteilen kann. — Zu seinen Lebzeiten wurde ein einziges seiner Lieder gedruckt und zwar in der Prager Monatsschrift „Deutsche Arbeit“. Es heißt „Unsere Gespräche“ (Text aus dem „Weg des Verliebten“ von mir). Diese Veröffentlichung ist Prof. Rietsch und Hans Effenberger zu danken. — Ein einziges Lied von so vielen, vielen unschätzbaren!
Ein Engagement in Pilsen scheint für Schreiber das entscheidende Erlebnis gebracht zu haben, das dann noch in Eger und bei einem Besuch in Wien ausschwang. Doch auch die Örtlichkeit „Bozen“ taucht in mir auf. Der verklungene Name „Ferra“ ... Ich entsinne mich mancher Andeutungen von einem stolzen Mädchen und einer glücklichen Liebe, wohl der einzigen, die‹ 45 › er erlebt hat, — obwohl viele Frauen ihn mit Liebe umgeben haben. Ja, es gab einigemal Frauen, die das Einzigartige dieses Mannes instinktiv begriffen und ihn in Sorgfalt, in selbstlosester, Peinigungen unzugänglicher Zärtlichkeit gehütet haben. Frauen waren in dieser Hinsicht feinfühliger als Männer, Künstler-Kollegen. Aber Hingabe, Bewunderung, Anbetung — das war ja etwas, was Schreiber erst recht nicht vertrug. So scheuchte er Seelen fort, die er angezogen hatte. Es gab immer Unglück und Öde um ihn. Dann wieder verschmachtete er vor Sehnsucht. — Welchen seltsamen Umständen nun es zu verdanken ist, daß gerade das Pilsener Erlebnis die richtige Balance von Stolz der Frau und ihrer Hingabe, von negativer und positiver Elektrizität besessen hat, — das fühle ich nur noch irgendwo im Dämmern der Erinnerung, Schreiber hat es mir wohl erzählt, nachformen kann ich’s nicht. Dunkel entsinne ich mich, daß eine gefährliche Erkrankung dieses Mädchens eine große Rolle gespielt hat. Ich kann es mir etwa so denken: Aufopferung und Schutzgewährung war ja so richtig Schreibers Element, am Krankenbett winkte eine seltene Kombination, wie er sie brauchte, die Stellung des hingebungsvollen Pflegers, die zugleich eine‹ 46 › beherrschende wie dienende ist. In dieser Stimmung mögen seine geheimsten Fähigkeiten hervorgebrochen sein, Gnade in seinem oft versiegenden Leben. So entstand die unsterbliche „Rekonvaleszentin“ und die verwandte Ballade „Maibaum“, die er „Und Pfingsten rings —“ nannte. Aber damit nicht genug. Eine Fröhlichkeit, ein üppiges Quellen der Sinnlichkeit wie nie zuvor und nachher nie wieder, besaß ihn in jener bergumhallten waldigen weichen Wiener Zeit. Ein Heft sehnsüchtiger „Walzer“ für Klavier zeugt davon. Schreiber schickte sie mir mit einem Brief voll Innigkeit für Wien, — „unaussprechliche Sehnsucht nach Wien, nach dem Leben, nach der Liebe — und so bitte ich Dich auch diese Walzer zu spielen, weich, zärtlich, kosend, gemüt- und gesangvoll. — Ich fühlte immer eine alte Erinnerung in mir aufleben — wie ich den Kopf an ihr Boa, das auf ihrer Brust lag, lehnend den zarten weichen Druck fühlte, mit dem sie meinen Kopf an ihre Brust preßte — das ist der Inhalt!“ — Zuerst glaubte er, Schnitzlers „Reigen“ in Musik zu setzen (mit diesen Walzern), dann aber fand er das Buch zu brutal, zu realistisch. — Auch schuf er eine ganz neue Form: „Gstanzeln“, kurze, oft nur zweizeilige Liedchen auf volkstümliche,‹ 47 › dialektische Texte. Er schrieb schnell nacheinander zwei solche Zyklen, die in ihrem Reichtum, rhythmisch und harmonisch originell, dabei von einleuchtender natürlicher Invention zu dem Besten gehören, was ich von ihm kenne. Daß diese Zyklen bald populär geworden wären und dabei den Beifall der Kenner erlangt hätten, scheint mir sicher. Aber Schreiber verwarf sie später vollständig, erlaubte mir niemals, daß ich mich um eine Aufführung gerade dieser aussichtsreichsten Arbeiten bemühte.
Ich kenne nicht den Namen des Mädchens, die meinem Freund so viel gewesen ist. Ich weiß nicht, wie sie auseinander geraten sind, wohin sie sich gewendet hat, wie ihr Leben in all den Jahren verlaufen ist, ich weiß gar nichts von ihr. Vielleicht hat sie ihn vergessen. Vielleicht ist sie tot. — Sollte aber irgendwo in der weiten Welt dieses Blatt zufällig in ihre Hand kommen, so nehme sie es ehrfürchtig erschauernd wie einen Gruß des Toten, — und meinen stillen Dank dazu für den überirdischen Lichtstrahl, der ins dunkle Herz eines bitteren Menschen gefallen ist. — — — — — — — —
An den „Walzern“ Schreibers bemerkte ich zum erstenmal eine Eigentümlichkeit seines musikalischen Stils: die Akkorde scheinen manchmal‹ 48 › unreif, nicht voll genug, oder plötzlich an Stellen, wo man es nicht erwartet, stumpf. Doch gilt es hier, im Urteil vorsichtig zu sein. Das sind nicht etwa Fehler. Sondern gerade solche scheinbare Ungeschicklichkeiten geben dem Duktus, nimmt man ihn nur einigemale durch (unerläßliche Bedingung!) und gewöhnt sich an seine Untiefen, einen wunderbaren Zauber von Unberührtheit, Naivität. — Ich würde diese Behauptung nicht wagen, wäre Schreiber der einzige Komponist, für den solche „scheinbare Ungeschicklichkeit“ charakteristisch ist. Daß man mir ohnedies vorwerfen wird, ich sei von Freundesliebe verblendet, weiß ich. Dies hier aber würde den Vorwurf allzusehr provozieren. Ich dürfte es also nur denken und — schwiege. Doch glücklicherweise findet sich bei Berlioz ganz ebendieselbe Eigenheit. Man höre etwa den Chant de bonheur (aus Lelio). Gleich der Übergang vom dritten zum vierten Takt zeigt genau diese leichte Härte, die ich meine. Aber wer würde solche Kristallkanten aus Berlioz wegwünschen! Gerade in ihnen ist er ja gleichsam: Berlioz zur dritten Potenz. Sie zeigen sich eigentlich überall in seinem Werk, offenbaren sich schamhaft, mit herbem jungfräulichem Reiz. — Der Banause tritt hin und streicht sie‹ 49 › als dilettantisch an. Ohren aus Nilpferdleder haben die Leute! — Um noch präziser zu sagen, worauf es hier ankommt: im 47. Takt desselben Chant de bonheur, bei der Sequenz auf das Wort „viens“ erwartet man in den Sechzehntelfiguren der Begleitung kein d, sondern ein e. So steht es auch im Vorspiel und Nachspiel. Hier aber — eigensinnigerweise — ein kindliches schulfibelhaftes d. Man könnte es fast für einen Druckfehler halten. Und es geht ja im Moment vorbei. Aber ein Duftmolekül aus dem Paradies ist mit vorbeigefedert. Diese Duftsprühtropfen liegen überall auf den Blütenblättern Berliozscher wie Schreiberscher Musik. Das ist ja keine große Sache. Unsere Zeit ist an derbere Bekundung von Eigenarten gewöhnt. Keine große Sache, — es ist nur das, was eben das wunderbare und geheime Wesen aller wahrhaftigen erlebnisnotwendigen Kunst ausmacht. Aber abgesehen davon ist es wirklich nicht der Rede wert.
Heute wird man einer Künstler-Eigenart erst gewahr, wenn sie sechsfach unterstrichen, wenn sie außerdem als deutliche Etikette oben aufgepappt, hundertmal wiederholt und dem starblindesten Kritikerauge sichtbar wird. Der Künstler, der nicht in zehn Büchern immer wieder denselben‹ 50 › einleuchtenden Grundeinfall vorkaut, hat keinen Stil, sein Profil verschwimmt im Nebel der Redaktionen. Tagore: ein Inder, da habt ihr was, daran könnt ihr euch anhalten, Weisheit des Ostens, milde Weisheit des Ostens, — aus diesem Brocken kann auch der mittelmäßigste Kopf einen Essai saugen, auf die intimere Verflechtung und Entwicklung des Autors pfeift er, Etikette genügt. Welch erschütternde „Wahrheit“ hat nicht Sternheim entdeckt: Die Welt wird immer materialistischer, Berlin voran, statt Persönlichkeitswerten gilt nur die Quantität, — eine Erkenntnis, bei der freilich ganze Bibliotheken von Autoren aller Gattungen (Lyrik bis Nationalökonomie) vorgearbeitet haben. Aber faßlich, unkompliziert schimmert sie, dem philiströsen Anti-Bourgeois erfreulich, durch hübsche Sprachvertracktheit hindurch. Ohne eine solche Marke ist Erfolg unmöglich. Mit Marke versehen hat mißverständlicherweise sogar gute Qualität manchmal Erfolg.
Adolf Schreiber hätte sich wohl nie zur Marke entwickelt. — Rufe ich mir seine Figur auf, — dunkle Augen unter hoher breitwölbiger Stirn, das blasse kindlich-runde Gesicht, rettungslos traurig oder hastig, verlegen lächelnd, den wie in Sturmwinde verlorenen, eilig hingeblasenen‹ 51 › Gang, den hohen mageren Körper, die enthusiastische Sprache, voll von Stößen und Fragen —, so erscheint er mir wie der Genius der Ehrlichkeit, ausgestoßen aus dem wohnlichen Umkreis der Menschen. Und das wird immer so sein. Nur Zufall oder die Gnade Gottes kann einmal ein Menschenkind, mit so viel Reinheit gesegnet, dem Untergang entreißen. Beten wir für die arme Seele der Menschheit! —
Es ist das Beschämende unseres Kunstlebens, daß nicht der lebenspendende Einfall, organisch entstanden und organisch weiterwachsend, der zarte Einfall, der Berge versetzt, weil er wahrhaftig aus einem übernatürlichen Erlebnis stammt, von Kritik und eiligen „Kunstgenießern“ gefühlt wird (die sogenannten „Edelfeuilletonisten“ miteingeschlossen) — sondern beliebt ist das möglichst banale Grundmotiv in möglichst outrierter Aufmachung. Gegen die Outrance als solche sage ich nichts. Auch sie kann (ist es bei Schönberg) göttliche Herzbewegung sein. Aber die herzlose Outrance, die Outrance, die das Allerhergebrachteste, den kalten Braten von vorgestern deckt, — sie ist die Feindin der Kunst. Gebt mir einen richtigen Kunstverständigen! Daran will ich ihn erkennen, daß er an dem aus Wahrheit entsprungenen Einfall sich‹ 52 › unlösbar festhakt, einerlei, ob es ein unscheinbarer, ins Gebüsch springender Mimikry-Einfall ist oder ein Einfall in krasser Plakatfarbe, plutzetoll. Auf beide Arten göttlicher Offenbarung reagiert gleicherweise der richtige Rezeptor. Und er weiß auch, daß die Physiognomie eines Wachsenden gewissen Veränderungen ausgesetzt sein muß. Aber er entlarvt a tempo den „scriptorem unius libri“, soll heißen: den Mann der Zeit, der dasselbe Buch hundertmal hintereinander schreibt, bis ihn die Kritikerzunft bei der neunzigsten Wiederholung desselben aufdringlich und auffallend herausgeputzten Fadismus endlich als „Charakter“, als „Individualität“ zu bemerken nicht umhin kann. —
Will man sich zu Schreibers Liedern historisch einstellen, so vergesse man nicht, daß alle in der gleichzeitig erscheinenden Sammlung*) veröffentlichten (außer „Tanz der Unsterblichen“ und „Das Huhn“) aus seiner Frühzeit stammen, in der von Einflüssen Schönbergs, Debussys nicht die Rede sein konnte. — Die Einfachheit vieler Schreiberscher Konzeptionen ist aber, das wird man sofort merken, weit entfernt von irgendeiner Schablone der Spätromantik, irgendeiner Schulkunst. In jedem Takt ist eigenes‹ 53 › Leben, oft nur durch feinnervige Abweichung vom erwarteten Akkord kenntlich, oft energisch neuer Biegung hingereckt (vgl. „Nach Catullus“ z. B. Takt 10–14, 23–25 und anderwärts). Absichtlich habe ich zwei der einfachsten Lieder („Wiegenlied“ und „Minnelied“) in diese Sammlung aufgenommen; nicht nur weil ihr Melos und ihre Harmonik unvergeßlich tönt, Erfindungen ein für allemal, wie seit jeher dagewesen und nur durch Zufall jetzt erst zu unserer Kenntnis gelangt (so ist das Gefühl, das jede große Musik erzeugt) — sondern weil gerade im einfachsten Material der neue Einfall am prätentionslosesten, am schönsten hervortritt. Man höre nur die Töne „zieht ein Traum“, „kräht ein Hahn“, die Schlußworte des Wiegenliedes, die akkordische Unruhe in „schlafe nicht ein“, die tiefe Innigkeit „lieb von Herzen sein“, das völlig hilflos, völlig primitiv liniierte „Ich werde sterben“ und die Gesangskurve, die danach aufgeht und hinab. Oder hat man die Holzschnittfarbe der „Fastnacht“, den zweistimmig geschnitzten Ländler und entzückendes Gespräch und klassisches, formkräftiges Regengemälde je zuvor erlebt? Hier wie in dem Zyklus nach Christian Morgenstern leuchtet überdies ein Humor durch, wie ihn der Mensch Adolf Schreiber kaum je zeigte. Über „Das‹ 54 › Huhn“ ist nichts zu reden, es wird bald sehr berühmt sein und auf den ganzen Zyklus neugierig machen. Wie bei den Worten „daß ihm unsre Sympathie gehört“ gleichsam ein ganzer Männergesangverein losbricht: genial, genial! Und als ich die Ballade „Trotzköpfe“ Professor Oskar Bie vorspielte, wunderte er sich, daß eine so intuitive Dramatik nicht längst in allen Konzertsälen erklungen sei. Kann man sich ein dankbareres Vortragsstück denken! (Die anderen Vorzüge will ich gar nicht besonders hervorheben, die wundervolle Variations- und Rondoform u. ä.) — Dieselbe Dramatik in dem tieferschütternden „Maibaum“. Wie haben mich die Nonen und Dezimen seines „Sensenschnittes“ zittern lassen — die melodische Linie, die sich zum Schlusse wiederholt — oder die aus unnennbarer, ganz dunkler Tiefe des Erlebnisses hervorgestammelten Worte: „und wenn du mich verläßt“. — —
Über die drei Lieder nach Liliencron-Texten liegt ein Brief des Dichters vor. Ich führe ihn hier vollständig an. Er ist für Liliencron wie für Schreiber charakteristisch. Schreiber hatte sich mehrere Freiheiten erlaubt, Zeilen weggelassen, den Titel geändert. Er war in dieser Hinsicht wie in manch anderer höchst‹ 55 › eigenwillig, Synthese von Adoration und Herrschsucht. So z. B. beharrte er darauf, zwei Zeilen in Liliencrons „Trotzköpfchen“ folgendermaßen lauten zu lassen: „Such dir ein ander Schätzchen wo, die wird durch deinen Reichtum roh“ ... statt „froh“, wie der Dichter geschrieben hatte. Ich stritt mit ihm öfters dieser „Emendation“ wegen und schließlich scheint er sie dem Dichter doch nicht vorzuschlagen gewagt haben. Aber im Manuskript hielt er natürlich eisern fest an ihr. — Einmal zeigte er mir einen sehr groben Brief von Bierbaum, der kurzerhand die Veröffentlichung eines ein wenig „geänderten“ Gesangstextes verbot. Der arme Schreiber! Es wäre ja vermutlich ohnedies nicht zur Veröffentlichung gekommen. Schreiber aber war damals wochenlang tiefbetrübt. — Der lebenstrahlende Baron hingegen antwortete wie folgt:
„Alt-Rahlstedt bei Hamburg, 11. 8. 7.
Hochgeehrter Herr Capellmeister,
Herzlichen Dank für Ihre drei herrlichen Lieder. Eben spielte Georg Kugelberg, unser großer Claviermeister, die Begleitung. Das erste wurde von den Zuhörern — es ist die 97. Composition meines Wiegenliedes — unendlich hoch aufgenommen. Aber ich fand „Trotzköpfe“,‹ 56 › das soviel ich weiß noch nicht componiert ist, außerordentlich charakteristisch. Und habe über Ihre Musik gejubelt!
Nun aber der Maibaum. Ich halte gerade die Str., die Sie weglassen wollen, für die besten. Und namentlich denke ich mir die Zeile: „Ein Wasser schwatzt sich selig durchs Gelände“ als besonders wertvoll für den — Componisten. Den Namen „Der Maibaum“ geb ich nicht her. Oder ich würde nur dann den Titel „Und Pfingsten rings“ erlauben, wenn Sie unten auf der Seite die breite Erklärung geben würden, weshalb Sie den Titel geändert und die vier Strophen weggelassen haben. Der gute Brahms hat zwei Gedichte von mir componiert. Das eine, bekannte, vorzüglich. Beim andern, das nichts taugt (was er übrigens selbst zugegeben hat), hat er ganz einfach den Titel geändert. Ich nenne es: Tiefe Sehnsucht. Und er hat ihm den albernen Titel: Maienkätzchen gegeben, ohne mich zu fragen — das kann ich ihm auch nach seinem Tode niemals vergessen. Herzlichen Dank nochmals für Ihre wundervolle Musik.
Ein Wandsbecker (Baisamburg?) Lehrer am Matthias Claudius-Gymnasium wird sich erlauben, Ihnen nach etwa 8 Wochen eine kleine‹ 57 › komische Oper oder Operette: Till Eulenspiegel vorzulegen. Er heißt Hugo Ritter.
Ihr ergebenster Detlev Baron Liliencron“.
Wie als Kapellmeister konnte sich Schreiber in siebenunddreißigjährigem Leben auch als Komponist nicht einmal eines Anfangserfolges rühmen. Kurt Hiller wollte Lieder von ihm im „neopathetischen Kabarett“ herausbringen. Im letzten Moment sagt der Sänger ab. „Erleichtert habe ich aufgeatmet“ schreibt mir Adolf. So stand er sich selbst im Wege, zumindest mit Gedanken und selbsthasserischem Wunsch. — Herwarth Walden kümmert sich um ihn, nützt ihn aber nur auf eine Art aus, die hier zu benennen mir widerstrebt. — Ein Lübecker Abend bleibt ohne Folgen. — Gegen das Ende hin veranstaltete die unendlich gütige Auguste Hauschner mühevoll werbend ein Konzert seiner Lieder nach Christian Morgenstern. Es war das erstemal, daß er vor erstklassige, gut eingeladene, wesentliche Öffentlichkeit kam. (Wenn durch nichts anderes sollte Adolf Schreiber dadurch berühmt werden, daß er es verstanden hat, vierzehn Jahre in Berlin zu leben, in engster Fühlung mit Künstler- und Theaterkreisen, und doch völlig unbekannt‹ 58 › zu bleiben.) — Selbstverständlich stand das Konzert unter einem ungünstigen Stern. Zuerst rezitierte Resi Langer, wie immer mit großem Erfolg. Die berühmte Sängerin aber (ihr Name sei verschwiegen) soll nur wenige Noten so gesungen haben, wie der Komponist in unerklärlichem Eigendünkel sie festgesetzt hatte. Im übrigen begnügte sie sich mit Improvisationen. Der Begleiter spielte den delikaten, überaus schwierigen Klavierpart — vom Blatt. Hier erkenne ich übrigens die Unglückshand meines armen Freundes: statt seine Schmierentournee laufen zu lassen, Urlaub für acht Tage zu nehmen und den entscheidenden Abend vorzubereiten, kam er erst am Vortage nach Berlin, schickte den Mann, der die Lieder bis dahin einstudiert hatte, als untauglich weg (am Vorabend des Konzertes), zerzankte sich mit der Diva usf. — Der Abend soll einem peinlichen Skandal nicht unähnlich geendet haben. Die Diva eilte auch schon zu ihrem zweiten Auftreten anderorts, an demselben Abend. Betrieb, Betrieb! Die Dame weiß wahrscheinlich bis heute nicht, daß auf diese Art die letzte Chance für einen großen Künstler unter ihrer freundlichen Mitwirkung verlorengegangen ist. — Seltsamerweise äußerte sich die Kritik nicht‹ 59 › ganz ungünstig über die gehörten Fetzen und Fragmente. „Berliner Tageblatt“ und „Börsencourier“ stellten Individualität fest. Daß nun jemand Interesse am Individuum dieser Individualität genommen und Schreiber „entdeckt“ hätte — das kann man vermutlich auf dieser Welt nicht verlangen.
Kein Zweifel, daß die Hartnäckigkeit der Mißerfolge Schreibers Herz ermüdet hat, — obwohl er nach außen hin diese Mißerfolge als gerechtes Los eines Nichtkönners hinzustellen eifrig bemüht war.
Doch das Wesentliche war das noch nicht. — Ich sehe die Briefe durch, die Schreiber im Laufe der zwei Jahrzehnte mir geschickt hat ... Nebenbei bemerkt: Diese Briefe sind in ihrer herrlichen Ursprünglichkeit große Dokumente einer Menschenseele. Auch sie sollten einmal veröffentlicht werden. Aber ist das möglich? Nur ein Faksimile könnte sie wiedergeben. Denn die seltsam charakteristische Raumverteilung gehört mit zu ihrem Inhalt. Alle sind gleichsam mit stürmender Hand hingeworfen, ohne Rücksicht auf Zeile und Gleichmaß; bald bedeckt ein einzelnes wichtiges Wort, ein schallender Ausruf die halbe Seite, bald stehen kleine Sätze über die Fläche hingestreut oder ein Initial, ein‹ 60 › Endbuchstabe wächst zu gigantischer Form, bald drängen sich die Worte eng, wie vor Angst zusammen, bald simulieren sie kälteste Kalligraphie, bald fallen sie ineinandergewirrt aus jeder Regel, die vielen Gedankenstriche als einzige Gliederung, mit Rufzeichen wie mit Girlanden umsteckt. Jede solche Briefseite gibt auf den ersten Anblick die Stimmung wieder, in der sie hingehaut worden ist. — In einem der kostbaren Schriftstücke fand ich den Satz, den ich an die Spitze dieser Erinnerungen setze. Ich zitiere hier den ganzen Brief:
„Gott sei Dank.
Soeben habe ich in einem Zug
Möchte rollend das Blut aller Verliebten sein (komponiert?) Gott sei
Dank — seit gestern Abend war ich in einer Aufregung u. wußte nicht
was es sei — heute schlug ich zufällig dieses Gedicht auf Ich bin
aber auch schon seit Deiner Abreise so gequält u. gemartert daß man
mit den Qualen ein Menschenleben erfüllen könnte
Ich liebe wahnsinnig
werde auch geliebt
und trotzdem keine Ruhe keine Rast ich weiß nicht mehr was ich soll
was ich tun soll das‹ 61 › Leben zu ertragen Es ist leichter Glut zu sein
als Mensch und zu glühen
Und dieser Flaubert dazu dieser Mensch der mich zum Wahnsinn bringt Dieser Heilige Antonius ist lichtes Feuer — brennendes sengendes Feuer — das ist ein Buch Sehnsucht nichts als Sehnsucht ich glaube kaum daß er ohne Brandwunden das Buch zu Ende geschrieben hat — ich kann das Buch nicht in den (Händen?) halten — der ich es nur lese
Er hat es geschriebenAndante“
Heute, wenn ich alles überblicke, scheint mir der innere Motor von Schreibers Kunst und Leben: eine schwelgerische Sinnlichkeit, dabei dem Tierischen und Gemeinen abhold. Alle Nerven vibrierend von Eros, dem aber gleichzeitig Liebe stets etwas Fernes, Geistiges, unendlich Zartes bedeutet. „Von dem Rosenbusch, o Mutter, von den Rosen komm ich.“ Grazie, Homophonie. Denkt man dabei nun etwa an „Filigranarbeit“, so ist man wiederum auf falscher‹ 62 › Spur. Denn Leidenschaft durchzuckte dieses Süße, Fein-Nervöse, niemals gab es Schonung, niemals Ausbastelung eines Schnitzwerks unter dem Glassturz; sondern Innigkeit vor allem, fern jedem Intellektualismus, das einfache Gefühl wie aus Volksliedern, brausender Strom des Lebens, selbstvergessene Hingabe durchdrang verworrenes Goldfadengespinst. — Aber verständlich ist es, daß er, der Lebenssüchtige, sich so brüsk vom Leben absperrte (und vielleicht war auch seine Ungeschicklichkeit nur verkleidete Brüskierung der Welt). Er stellte nämlich so hohe Forderungen an das Reale, daß sie nicht honoriert werden konnten oder nur in ganz außergewöhnlicher Konstellation, — das Leben sollte lieblich sein und doch auch heroisch-wild, rasend vor natürlichem Blutschwall und gleichzeitig kalt und tugendrein wie das forschende Lichtauge des Gelehrten. Als Mensch wie als Künstler blieb er stets auf nahezu Unmögliches angewiesen; da er dies wohl fühlen mußte, verdoppelte er seine Wut und Verachtung des Möglichen, Durchschnittlichen. Daher hat er auch sich selbst immer mißtrauisch beobachtet, gehaßt, verworfen. Um so wilder brach freilich manchmal sein Lebenswille aus, und geschah es unter glücklichem Stern, so mochte es wohl Küsse geben oder‹ 63 › entsprangen Akkordfolgen, die selbst für dies qualvolle Leben entschädigten. — Seine Liebesfreude, seine Regungen zu Leichtigkeit und Leichtsinn hin klingen bezaubernd aus den Liedern, schmal schwingendes Blendlicht vor Nachttapeten des Todes. —
Mein Freund hat in der Ehe kein Glück gefunden. Seine Gattin war stets redlich um ihn bemüht geblieben, im Sommer 1920 aber wurde die Krise unvermeidlich. Schreiber verließ seine Wohnung, jedoch nicht etwa in Unfrieden. Er gab dort noch öfters seine Lektionen, sprach freundschaftlich mit der Frau, so oft sie einander trafen. Er wohnte bei Bekannten, schließlich nahm er ein Zimmer für sich. In der Wahl seiner Geliebten, um deretwillen er von seiner Frau (nach langen inneren Kämpfen) weggegangen war, scheint er ebenso unglücklich gewesen zu sein wie in allen anderen Dingen. Diese Freundin kümmerte sich bald nicht mehr um ihn, sie ließ ihn, um den sich in besseren Zeiten so viele Frauen heiß beworben hatten, einfach untergehen, überließ ihn sich selbst und seiner totalen Unfähigkeit, die Dinge des praktischen Alltags, in Nachkriegs-Berlin doppelt‹ 64 › schwierig, zu bewältigen. Verwahrlosung, körperliche Schwäche, schlechte Ernährung haben denn auch daran mitgewirkt, die latente Melancholie seiner Seele zur Entladung zu bringen.
Juli und Anfang August 1920 verbrachte er im schönen Kurfürstendamm-Heim seines skandinavischen Freundes, Herrn Jens Gjerlöw, dessen Gesangslehrer er war. Unter der Adresse des Herrn Gjerlöw hat er auch noch meinen letzten Brief erhalten, in dem ich ihm meinen Besuch für November ansagte. Ich stellte es mir als einen Hauptzweck dieser Berliner Reise vor, in seine immer verworreneren Angelegenheiten einige Ordnung zu bringen. — Daß ich seinen Nachlaß würde ordnen müssen, träumte mir nicht. Und doch empfand ich seltsame Unruhe. Adolf antwortete nicht. Bis dahin war ja unsere Korrespondenz eine ziemlich regelmäßige geblieben. Eines Morgens erwachte ich mit dem festen Entschlusse: Ich muß nochmals schreiben, nachfragen. Gerade äußerte ich, daß Adolfs ganz ungewohntes Stillschweigen mich beunruhige, da hören wir (in eben demselben Moment) ein Papier in den Briefkasten fallen. Es war das Telegramm, das seinen Tod meldete ...
Die Gründe seines Selbstmords sind dunkel. Keine Zeile hat er hinterlassen. Wie weit die‹ 65 › unaufhörlichen Enttäuschungen, die Energieschwächungen aller Art, an diesem Ende beteiligt sein mögen, — wer könnte das enträtseln. Offen zutage aber liegt wo nicht die Ursache, so doch das letzte Motiv. Was hat sozusagen dem Faß den Boden ausgeschlagen? Eine häßliche Theateraffäre. O unsäglich traurig, in diesen Dingen zu wühlen, wo schuldlos-schuldig Mensch gegen Mitmensch steht. — Schreiber war zuletzt als Kapellmeister am „Künstlertheater“ (Nürnberger Straße) engagiert. Unter Direktor Palfi, mit dem er auch früher einmal schon jahrelang gearbeitet hatte und der ihn als gewissenhaften, schließlich auch schon nolens volens routinierten Operettenkapellmeister schätzen mußte. Schreiber leitete alle Proben für die neue Operette, mit der die Saison eröffnet werden sollte. Da er, wie schon erwähnt, musikalische Einzelheiten auch niederer Kunstgattungen ungewöhnlich wichtig nahm und eine reichliche Portion Eigensinn besaß, scheint es ohne den üblichen Kulissenzank nicht abgegangen zu sein. Doch nicht dies war der Grund dafür, daß ihm plötzlich, ganz unvermutet bei der Generalprobe die Partitur abgefordert wurde. Vielmehr ergab es sich aus dem an Berliner Bühnen eingebürgerten Verleihsystem: Die Premiere mußte von einem „bekannten‹ 66 › Namen“ dirigiert werden. Mein Freund sollte nur die Plage des Einstudierens und die späteren, von niemandem bemerkten Reprisen haben. In normaler Gefühlslage hätte er diese Kränkung weggelacht, zu den übrigen gelegt. Diesmal (vielleicht war gerade das Maß voll) gab es ihm den Rest. — Über das Weitere orientiert der nachfolgende Brief, der auch seinem Verfasser, Herrn Gjerlöw, das schönste Zeugnis edlen Menschentums ausstellt. Wie rein hebt es sich von dem empörenden Kaltsinn ab, den die Theaterleute auch noch nach der Katastrophe bewiesen haben. Fünf Tage lang konnte die Witwe keine Auskunft von ihnen erhalten, obwohl die Tasche des Vermißten noch am Unglückstage selbst im Grunewald, am Wasser gefunden worden war. Hier ist allerdings eine Vollendung Berlinerischer Organisation und Zeiteinteilung erreicht, bei der das Herz erstarrt! —
Als ich dann im Dezember nach Berlin kam, sah ich noch an allen Litfaßsäulen die tödliche Operette angezeigt. Ihr Titel: „Die Scheidungsreise“ — fiel mich symbolhaft an. Sie soll einen großen Erfolg gehabt haben. Einer hatte sie einstudiert, — der faulte im Wasser.
Der Brief des Norwegers, vom 14. September, lautet:
‹ 67 ›
„Ich werde Ihnen berichten, was ich weiß über Adolf Schreibers letzte Tage.
Ich hatte ihn — mit Mühe — dazu gebracht, daß er in meiner Wohnung lebte, die Zeit, die ich verreist war. Ich kam Sonnabend, 14. August, zurück, fand hier eine Karte für ihn, die ich ihm Sonntag vormittag in seine neue Wohnung brachte. Ich sah ihn schon auf der Straße, wie er daherkam, zerstreut um sich blickend — für mich ein rührender, doch auch trauriger Anblick — ich rief ihn an, und er meinte, es wäre schön, daß ich mich um ihn kümmerte. Wir gingen auf sein Zimmer (Friedbergstraße 4) und ich gab ihm die Karte (von Frl. M., seiner ‚Liebe‘). Er sagte, das wäre das erste Lebenszeichen seit drei Wochen. Wir sprachen weiter von diesem ‚Fall‘ — und er sagte, es wäre ihm unverständlich, wie ein Mensch, von dem er doch gesehen hatte, wie er sich unter seinem Einfluß änderte (und insofern wohl auch besserte) im selben Moment, wo sie nicht mehr zusammen waren, dies alles quasi abstreifte. — Dazu ich: Das wäre mir leider sehr wohl verständlich — Menschen mit 40 Jahren, und dazu Theatermenschen, sind wohl überhaupt nicht mehr zu ändern, jedenfalls nicht par distance.‹ 68 › Ja, dann wollte er nicht mehr leben — wenn er nicht einen einzigen Menschen halten konnte — dann hatte er in allem verspielt. Dazu ich: es wäre doch ein Unsinn, sein Leben davon abhängig zu machen, ob man einem ixbeliebigen Menschen, den man noch dazu nicht in der Nähe habe, sozusagen neuformen könnte oder nicht. — Das wäre überhaupt eine ziemlich unbescheidene Forderung, — er sollte lieber schauen, daß er mit seinem eigenen Leben besser fortkäme und lieber zu Helene zurückkehren. — Diese Liebe brachte ihn ganz auf den Hund. Er konnte als Korrepetitor sehr vielen Menschen nützlich sein und dabei auch viel Geld verdienen — aber diese Liebe brachte ihn auch in seiner Arbeit herunter.
Nun, wir sprachen noch viel — ich lud ihn zu Mittag ein, was er wie immer nicht annehmen wollte. Dafür kam er zum Tee nachmittags — wir sprachen wieder hin und her — und wenn ich jetzt alles zusammenfasse, glaube ich, daß Adolf, dieses reine Kind in puncto: Frauen — vielleicht zum erstenmal eine Frau erotisch liebte —, und zwar eine Frau, die ihm weder menschlich gleichwertig war noch überhaupt verwandt .................
‹ 69 ›
Helene sagte mir, daß er diese Frau früher gehaßt und verachtet habe. Mirabile dictu.
In der folgenden Zeit kam er öfters nachmittags zu mir zum Begleiten, war aber meistens gedrückter Stimmung. Er wurde dann engagiert, als Kapellmeister im Künstlertheater vom 1. September, von Regisseur Palfi.
Dies half — vor allem wohl, weil er hoffte, Frl. M. dort als Soubrette anbringen zu können.
Er hatte nun viel zu tun mit den Proben im Theater, und ich war etwas krank, aber auch beruhigt, daß er sich durch diese neue Anstellung und Arbeit wieder neuen Mut holen würde, so daß ich mich einige Tage nicht um ihn kümmerte. Er rief ein paarmal an, daß er nächstens kommen würde. —
Freitag, 3. September, morgens sah ich in der Zeitung, daß ein Dr. Günther dirigiert hatte und rief gleich bei Helene an, wie das käme. Sie wußte von nichts. Adolf wäre seit Dienstag nicht bei ihr gewesen — und selbst hat sie ihn seit Montag nicht gesprochen.
Ich ging dann gleich in seine Wohnung (Friedbergstraße 4). Da war er nicht gewesen seit Mittwoch früh. Soweit ich dann habe feststellen können, ist er Mittwoch ins Theater, wo er schon viel Krach gehabt — mit Komponist‹ 70 › Hirsch und Palfi — hier hat er den neuen Kapellmeister Günther, ‚der die ersten Vorstellungen leiten sollte‘, vorgefunden. Dieser, ein guter Bekannter von ihm, war peinlich berührt, er wäre aber gerufen worden. ‚Selbstverständlich dirigieren Sie, ich aber komme nicht wieder‘. — Davon ist er wohl gleich nach Wannsee gefahren; seine Uhr ist im Wasser 12⁵⁵ stehengeblieben. —
In seiner Wohnung habe ich gleich nach dem Theater telephoniert, sie haben mir aber jede Auskunft verweigert. Helene haben sie höflich geantwortet, sie wüßten nichts — dabei ist seine Mappe Mittwoch am Wasser gefunden worden, und weil ein Brief drinnen war an Herrn Komponisten Hirsch, hat der Finder dort Donnerstag angerufen. Dies hat Frau Schreiber erst Montag erfahren, dadurch, daß sie persönlich ins Theater ging. Sonnabend bin ich weggefahren — Montag abend zurück — Dienstag morgens sagte mir Helene von dem Fund der Tasche. Sie ging dann zur Polizei, wo ich schon Freitag gewesen bin. Mittwoch mußte sie nach Wannsee zur Gendarmeriestation, um anzuzeigen — und bat mich, mitzufahren. Auf der Station kein Gendarm. Wir sind allein dorthin, wo die Tasche gefunden‹ 71 › wurde. Hier habe ich ihn im Schilf gesehen, aber nichts gesagt, — Helene war schon so zu aufgeregt. — Ich habe sie dann wieder nach Hause gebracht — habe mir ein Handtuch geholt und bin wieder hinausgefahren.
Da lag unser Adolf auf der Brust im Wasser — ich habe ihn hereingeholt — da war er genau eine Woche im Wasser gewesen —
Wir haben nun alles geordnet mit der Polizei usw. und morgen den 15. Septbr. wird er auf dem Jüdischen Friedhof begraben, früh um 10¼.
Er hat nichts schriftliches hinterlassen — auch kein Testament. So ist unser Adolf aus dieser Welt gegangen; wo er sich nicht zurechtfinden konnte. Er ist von selbst gegangen — aber Gott, der alles weiß — wird schon wissen warum — und dieses Kind, das nichts war als Güte und Liebe, an sein Vaterherz drücken. — Ein norwegisches Sterbelied, das wir hier gesungen und das er abgeschrieben, hatte er bei sich in der Brieftasche. — Es heißt da — „Besser kann ich nicht fahren als zu meinem Gott — besser kann ich nicht antworten, wenn der Tod mir Botschaft schickt, als daß ich bin wohlbereit und will gerne‹ 72 › folgen“. Und zuletzt — „Denn Gottes Wohnung hat Frieden in allem Überfluß“. —
Ich habe Ihnen dies möglichst knapp geschrieben, werter Herr Brod, wenn Sie hierherkommen, werden wir noch alles durchsprechen.
Er war mir von Herzen lieb und mein einziger Freund hier, — und ich habe seinesgleichen nicht getroffen.
Ihr
Jens Gjerlöw“.
Im Nachlaß Adolf Schreibers befindet sich außer den schon hier erwähnten Kompositionen eine große Anzahl von Liedern, wohl 200, ein Chor mit Orchester („Lenore“ von Bürger), ein zweites großes Chorwerk mit Orchester und kleine Chöre a capella, ein Zyklus nach Rilkes „Marienleben“ für Gesang, Klavier und obligate Viola (geschrieben 1915–1916), eine Sonate für Klavier und Violine, der Zyklus von Christian-Morgenstern-Liedern, Bühnenmusiken zu meinen Dramen „Die Höhe des Gefühls“ und „Abschied von der Jugend“, Klavierstücke usf. Der größere Teil der Skripten ist noch ungesichtet.
‹ 73 ›
Eine Überraschung war es selbst für mich, seinen intimsten Freund, auch — Dichtungen vorzufinden, Novellen und dramatische Szenen. Nie hat Schreiber ein Wort von dieser Seite seiner Begabung auch nur angedeutet. — All die wilde Prosa (Raumanordnung wie in den Briefen) trägt das Datum 1903, scheint binnen wenigen Tagen hintereinander hingelegt. Grausame Themen, das Ich im schmerzlichen Aufruhr gegen eine häßliche Umwelt, die Stimmung etwa von Flauberts Jugendpoesie, übrigens durchaus ursprünglich, ohne literarisches Muster. —
Wäre ich naiv genug gewesen, die Welle von Sensation, die nach Adolf Schreibers Tod durch die Öffentlichkeit ging, irgendwie ernst zu nehmen, als Zeichen innerer Aufweckung und Teilnahme: dann hätten meine Bemühungen um Schreibers Nachlaß mich wieder einmal empfindlich getäuscht. — Doch ich hatte es im voraus so vorgesehen. Als ich nach Berlin kam, war der kleine Zwischenfall schon wieder vergessen. Einige hatten ihn gar nicht bemerkt. Von Künstlern, erlesenen Menschen, denen ich Schreiber ans Herz gelegt hatte, wurde ich, drei Monate nach seinem Ende, konversationsweise gefragt, wie es dem Herrn Kapellmeister gehe. Sie wußten noch nichts ... Berlin ist groß.
‹ 74 ›
Dann saß ich in seiner Wohnung, an seinem „Blüthner“. Ich sah nochmals seinen Stolz, die mit dem edelsten Geschmack zusammengebrachten Bücher und Noten. Das Bild Smetanas, ernst blickt es herab, Leidenswasser im Auge. Die Reiseandenken, die seltsamen Nippesfiguren, denen er zugetan war ...
Hart, ungerührt saß ich da, erstaunt über die unsentimentale Stimmung. Aber sie war vielleicht eine Huldigung an ihn, der Gefühlsausbrüche, ihm gewidmet, niemals gelitten hätte. — Stundenlang nahm ich Notenblätter aus den dichtgefüllten Mappen, spielte, probierte da und dort. Erinnerungen an jenes Pianino im Gartenhaus, an die erste Offenbarung seiner Kunst. O Tage der Jugend, wie anders haben wir es geträumt! Und auch später noch — in all seinen Hoffnungslosigkeiten war es doch immer noch Leben gewesen, halbunbewußte Kraft, Erfindung, federndes Vorwärts, unbenützte Reserve, der Funken, der Schlag, das Ich-weiß-nicht-wohinaus, der freie unerforschbare Horizont! Und nun — alles vorbei! Weil (letzten Endes) der Star so und so die Première dirigiert hat! O Blödsinn, Blödsinn unserer Zellanordnung, unseres unmöglichen Daseins, unserer Majestät von Zufalls Gnaden ... Und nun‹ 75 › stoße ich auf seine lieblich-sehnsüchtige Wunderhornmelodie: „Der verlorene Schwimmer“: „Er rief aus voller Brust — mein Stern ist aufgegangen — ich schiff ihm nach mit Lust. — Das Lichtlein auf den Händen — er schwamm zum Liebchen her. — Wo mag er hin sich wenden — ich seh sein Licht nicht mehr? — Liegt er in ihrem Schoße, sein Lichtlein wendet ab — liegt er im Wasserschlosse, in einem nassen Grab“ ... Da konnte ich nicht länger an mich halten ...
Es ist merkwürdig, wie viele Prophezeiungen unter den Liedtexten sind, die Schreiber ausgewählt hat.
Allenthalben grenzte, stieß sein Leben an das große Geheimnis. Überirdisches ist ihm zuteil geworden und Leidenschaft erfüllte ihn zuzeiten völlig, von oben bis unten. — Und auch jetzt noch lebt Musik in der verlassenen Wohnung, als könnte mit einem Schlage diese starke Flamme nicht ausgelöscht sein. Ein Wunderknabe mit tiefen schönen dunklen Augen, zwölfjährig, schon heute ein sicherer Meister der Geige — Adolfs Frau hatte das ostjüdische Kind zu sich genommen um dem Künstler eine Freude zu bereiten, nun blüht das Kind unter der Hand der Witwe. Mit der übernatürlichen Besonnenheit‹ 76 › des Genies, ein Schuljunge noch und doch durchaus mit der Fassungskraft Erwachsener begabt, erzählt es von seinem Pflegevater, zu dem es doch erst vor einem halben Jahr gebracht worden ist, — von gemeinsamen Spaziergängen mit unablässigem musikalischem Gespräch. Alle Dreiklänge, alle Septimenakkorde aufzählen, bis der Mund weh tat, — das war eine Kleinigkeit für Adolfs Pädagogik. Ja, daran erkenne ich seine quälerische und selbstquälerische Methode wieder. Wenn irgendwo eine Türe aufging, eine Autohupe erklang, mußte sofort der absolute Ton erraten werden. Sie erfanden ein Spiel daraus, überboten sich im Auffinden dieser Zufallsgeräusche. Ja, man hat viel von ihm lernen können. Und diese Begeisterung, wenn er von den Meistern sprach! ... So macht mir der kleine Violinvirtuose meinen Freund noch für ein Weilchen lebendig. Und erfreut mich durch sein stillbescheidenes, sanft bedeutsames, ausgeglichenes Wesen, so unähnlich dem zerschellten Chaos meines Freundes. Möge ihm, der über dem Grab eines Schicksals-Ungünstlings aufwächst, alles gelingen, was diesem mißlungen ist!
Herr Gjerlöw hat mir noch einen zweiten Brief geschrieben. Da heißt es: „Ich werde mit dieser Sache nicht fertig — muß immer wieder‹ 77 › an Adolf denken — und mache mir Vorwürfe und sage ‚wenn und wann‘, dann wäre es vielleicht nicht so gegangen. — Sehr viel habe ich hierüber noch zu sagen — aber das Schreiben ist mir zuwider, auch geht es so langsam. Ich muß Adolf immer mit Caspar Hauser von Wassermann vergleichen — so einsam und unbeholfen, und wir alle haben so träge Herzen gehabt. — Wenn Sie kommen, werden wir über alles reden. — Sie müssen ein Buch schreiben — eine Warnung für harte und träge Herzen.“
Druckleitung, Titel u. Einband: Menachem Birnbaum.
Druck von C. G. Röder G. m. b. H., Leipzig. 817521.
Gleichzeitig erschien im Welt-Verlag:
ZEHN LIEDER VON ADOLF SCHREIBER
für Gesang und Klavier.
Geheftet M. 25.—.
WELT-VERLAG / BERLIN NW 7
HEDWIG CASPARI: Elohim. Gedichte. 2. Aufl. Geb. M. 15.—.
— Salomos Abfall. Eine Handlung in neun Vorgängen. Geh. M. 17.—, geb. M. 23.—.
SAMMY GRONEMANN: Tohuwabohu. Roman. 8. Aufl. Geh. M. 25.—, geb. M. 30.—.
LUDWIG STRAUSS: Die Flut Das Jahr Der Weg. Gedichte 1916–1919. Geh. M. 15.—, geb. M. 20.—.
HERMANN STRUCK — ARNOLD ZWEIG: Das ostjüdische Antlitz. Mit 50 Originallithographien. Geb. M. 50.—.
ARNOLD ZWEIG: Drei Erzählungen. Geh. M. 5.50, geb. M. 9.—.
L. SCHAPIRO: Die Stadt der Toten und andere Erzählungen. Aus dem Jiddischen von S. Schmitz. Geh. M. 5.—, geb. M. 7.50.
LYRISCHE DICHTUNG DEUTSCHER JUDEN. Verse von Franz Werfel, Max Brod, Albert Ehrenstein, Else Lasker-Schüler, Ludwig Strauss, Hedwig Caspari, Rudolf Fuchs, Oskar Kohn, Uriel Birnbaum, Alfr. Wolfenstein. Geh. M. 9.50, geb. M. 12.—.
Verlagskatalog steht zur Verfügung.